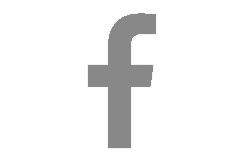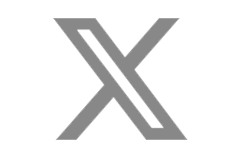Romantisches Musiktheater als pathologischer Fall
Robert Schumanns Oper "Genoveva" in Zürich
Von Manuel Brug (Die Welt, 19.02.2008)
Opernirrenhaus, geschlossene Abteilung für heillose Romantiker. Eine grellweiße Zelle. Darin ein Waschbecken und ein Biedermeierstuhl. Draußen im schwarzen Raum tobt der Vormärz-Mob, dreckig verschmierter Pöbel mit aufgepflanzten Bajonetten. Drinnen aber liegen, sitzen und starren aneinander vorbei vier Personen, zwei böse und zwei gute. Am Ende sind die einen - Golo und Margaretha - tot, mit durchschnittener Kehle, und die anderen - Siegfried und Genoveva - ein nun angeblich glücklich liebendes, durch schwerste Prüfung gegangenes Paar. Nur merkt man davon nichts. Umnachtet stieren sie auf eine Heerschar von Gipsmadonnen, die als Zeichen allzu plumper Devotionen vom Volk um sie herum abgestellt wurde. Auch Rolf Glittenbergs Bühnenzimmer ist jetzt so missbraucht und geschändet wie sie, mit Blut, Urin und Ruß an den Wänden.
Der Regisseur Martin Kusej hat sich klug beschränkt bei seiner jüngsten Premiere im Zürcher Opernhaus. Schließlich mutet ihm Robert Schumann mit der 1850 in Leipzig uraufgeführten "Genoveva", seinem einzigen, erfolglosen Musiktheaterversuch einiges zu: Eine eigentlich unspielbare Handlung um eine damals noch populäre, von Ludwig Tieck wie Friedrich Hebbel literararisierte Heiligenlegende als Musterbild ehelicher Keuschheit, heute höchstens von dem Moritz-von-Schwindt-Bild noch kunstgeschichtlich bekannt; verquere Figuren mit einer verquasten Sprache, eine an dramatischen Schanierstellen nicht zu Potte kommende, unpräzise, gleichwohl faszinierende Musik mit seltsam klappernder Metrik und furios aufflackernden Geistesblitzen.
Das kann man kaum inszenieren und deshalb haben die meisten Theater bisher die Finger von diesem untoten Opernunikum gelassen. 1995 kam das Werk in Bielefeld heraus, vier Jahre später versuchte es Achim Freyer in Leipzig spektakulär als von lauter singenden Ampelmännchen geführten Parabel-Parcours sicher ins Ziel der treulich geführten Zweisamkeit: eine Opernverkehrsschule der besonderen Art. 2000 sind Aufführungen in England beim raritätengierigen Garsington Opera Festival und in der Regie von David Pountney beim Edinburg Festival aktenkundig. 2005 wurde das Werk konzertant mit Annette Dasch in Wien gegeben und fand ebenfalls konzertant die amerikanische "Genoveva"-Premiere in Boston statt; ein Jahr darauf die szenische in einer Inszenierung des Kopenhagener Opernintendanten Kasper Bech Holten beim Bard Festival.
Und nun versucht Martin Kusej in Zürich, was aufgeklärtes Regietheater eben so tut, wenn es keine Lösung weiß: die Handlung in die Entstehungszeit zu verlegen und in einem Einheitsraum eine irreale Parabel zu spielen - alles nur Theater als knappes Personenführungs-Handwerk, mit biografischem Hintergrund versteht sich.
So wird das infernale Trio Golo, Siegfried und Genoveva auch optisch historischen Vorbildern folgend aufgespalten in Robert Schumann als schizophrene Doppelgestalt seiner beiden literarischen Alter Egos Florestan und Eusebius sowie Gattin Clara, die hier die still in christlicher Demut darbende Genoveva vorstellen muss. Wo man nichts rational begründen kann, sollen wenigstens momentane Spannungszustände fesseln. Bis hin zu den seltsamen Traumbildern im Zauberspiegel, wo hier eine Chirurgentruppe eben jene Fische (Schuberts launische Forelle?) auf die nackte Genoveva wirft, die schon vorher am Boden zuckten oder schön blutig an die Wand gepflockt wurden.
Dem schaut man durchaus neugierig, aber wenig berührt zu. Die ganze Aufmerksamkeit aber erheischt im Graben Nikolaus Harnoncourt, der wunderbare Dirigierdoktor und unermüdliche Relativierer der Musikgeschichte, der gewohnt furios eine unterbewertete Partitur analysiert wie seziert. Da blökt gestopftes Blech und splittert der spröde Geigenteppich. Unerbittlich wird vorgeführt, wie Schumann hier in einer Mischung aus sinfonischer Achterbahn und unorthodoxem Opernabenteuerspielplatz alle Gattungsgesetze negiert, ohne freilich neue Regeln aufstellen zu können. Man möchte Harnoncourt, der Schumanns Opernschmerzenskind bereits 1996 eingespielt hat, gern glauben, dass hier ein Kunstwerk missachtet wird, "für das man auf die Barrikaden gehen muss" - allein: man bleibt auch nach dieser Begegnung apathisch im Parkettsessel sitzen.
Dabei sind auch die Sänger mit all ihren Defiziten richtig besetzt: Cornelia Kallisch als schrille, farbige Hexe, Shawn Mathey mit nicht schönem, aber ausdruckstarkem Tenor als zerrissener Intrigant, der Genoveva heimlich liebt und sie trotzdem verleumderisch dem Untergang weiht. Martin Ganters wohlgerundete Stimme ist ganz Baritonruhe in der Gefühlsbrandung des vermeintlich betrogenen Ehemannes und Juliane Banses doch etwas verhärmter Sopran passt zum Märtyrerin-Heimchen, dass sich in der Schlussszene noch frei singt. Trotz der sinnfälligen Zürcher Anstrengung wird die problematische "Genoveva" wohl weiterhin nicht repertoirefähig werden.
DIE WELT, 19.02.2008, Nr. 42, S. 25