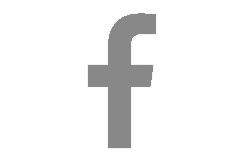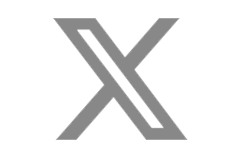Schumann-Sensation in Zürich
Von Wolfram Goertz (Rheinische Post, 19.02.2008)
Schumann-Sensation in Zürich Im Opernhaus Zürich hatte Robert Schumanns vergessene Oper "Genoveva" Premiere. Regisseur Martin Kuej und Dirigent Nikolaus Harnoncourt rehabilitierten sie genial - als psychoanalytische Studie über Schumanns Leben. Von Wolfram Goertz Zürich Der Dirigent Nikolaus Harnoncourt besitzt im deutschsprachigen Raum eine solche Majestät, dass ihm das Opernhaus Zürich, dem er innig verbunden ist, auch Spezialwünsche abnimmt. Dort hat er Rares von Haydn und Schubert aufgeführt und Monteverdi zum Hochadel gefördert, jetzt überrascht er mit Robert Schumanns seltsamer "Genoveva".
Dieser Oper ist er seit je treu liebend zugetan. "Genoveva" (1850 in Leipzig uraufgeführt, nach einigen Achtungserfolgen ins Schattenreich der Archive überführt) handelt von ehelicher Treue, von leidenschaftlich-verbotenem Liebesüberschwang, von Ehe als strengem Besitzstand, von frommer weiblicher Disziplin - und gehört eigentlich nach Leipzig oder ins Rheinland. Hier hat Schumanns Leben und Wirken tiefe Spuren hinterlassen, doch weiß keiner mit dem gipsern-undramatisch wirkenden Opus etwas anzufangen. Dabei steckt Sprengstoff darin und bewusste, unbewusste Biografie. Regisseur Martin Kuej hat "Genoveva" jetzt in Zürich aus mittelalterlich zugerüsteter Schauerromantik in eine zeitlos geschlossene Anstalt verlegt - in Rolf Glittenbergs Schleiflackhölle, in der Lebende zu Toten werden.
Die Oper spielt mithin in der Heilanstalt Bonn-Endenich, wo Robert Schumann 1856 starb - und Siegfried und Golo sind jetzt Schumanns doppeltes Alter Ego; der Komponist hatte ja ein durchaus dramatisches Verhältnis zur Schizophrenie. Zugleich ähnelt Genoveva, die madonnenhaft Keusche und von Gefühlen Umzerrte, in diesem vitalen Laboratorium niemand anderer als Schumanns Gemahlin Clara, geborene Wieck. Dieses Szenario ist kein brutaler Psychocoup eines Regisseurs. Ku- ejs Anordnung hat Schumanns Leben wie einen Spiegel neben die Handlung gestellt, und wer diese Biografie kennt, der denkt, wenn er die Figuren sieht, an Friedrich Wieck und seinen Ziehsohn Robert, die im Ringen um Clara aneinander verzweifelten; denkt an Robert, der Clara als Heimchen am Herd vor der Welt wegsperrte; denkt an Johannes Brahms, der wie ein junger Golo in die Familie Schumann eintrat. All das zeigt Kuej, ohne es windschnittig zu betonen. Es erschließt sich von selbst und wirkt um so stärker.
Und während Harnoncourt am Pult die Geburt Schumanns aus dem Geist lyrischer, drängender Poesie feiert (seine Holzbläser klingen herrlich atmend und schlackenlos, die Streicher spielen völlig ohne Vibrato, das Blech attackiert furios), macht sich der Hörer Gedanken, wieso "Genoveva" bislang so ungeliebt bleiben konnte. Vielleicht weil man die Ritterromantik, die Frömmigkeits- und Demutszeichen, die spukhaften Zauberszenen und das massenhaft pöbelnde Volk für Szenen eines opulenten Schlachtengemäldes des 19. Jahrhunderts hielt, dem Schumann nur trappelnde Marschklänge, ätherische Himmelschöre und wonniges Parlando beigab. In Wirklichkeit ist die Musik - bei allen Holprigkeiten eines opernunerfahrenen Komponisten - stellenweise hinreißend, zumal sie filmisch mit Überblendungen arbeitet. Gesungen (mit Juliane Banse in der Titelpartie) wird verdienstvoll, aber nicht so eindruckgebietend, dass die Buhrufer stumm geblieben wären. Durch den Eindruck künstlicher optischer Ferne bekommt die Musik, sich dechiffrierend und entschleiernd, eine ganz neue, beinahe jungfräuliche Kraft.
Sie ist nicht mehr Ausdruck wuchtig getäfelten Biedermeiers, sie kündet vom Geist der Dresdner Mai-Revolution und weiß, wie dumpfe Masse reagiert, wenn sie sich ein Opfer ausgesucht hat (hier ist es Genoveva). Sie atmet aber auch nazarenische Unschuld und stürmischen Schwung. Es ist echter, oft wundervoller Schumann. In Zürich sieht seine "Genoveva" also aus, als habe ihr Komponist mindestens August Strindberg gekannt. Das Publikum war irritiert und berauscht zugleich. Es erlebte eine Sensation.
Rheinische Post Nr. 42 vom 19.02.2008