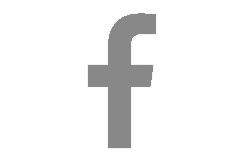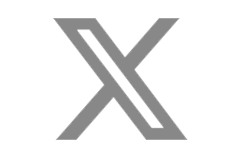Wagners Glück und unsere Freude
Schumann „Genoveva“ in Zürich (17.2.)
Österreichische Musikzeitschrift
3-4/2008, Seite 75-76
Monika Mertl
Die bewusste Frage, ob Schumanns einzige Oper überhaupt „bühnentauglich“ sei, stellt sich erst gar nicht. Die Aufführung, die Nikolaus Harnoncourt und Martin Kušej am Opernhaus Zürich erarbeitet haben, ist von vornherein über jeden Einwand erhaben. Und zwar nicht nur, weil der Dirigent den prominenten Germanisten Peter von Matt vorweg gebeten hatte, ein Machtwort bezüglich des routinemäßig gescholtenen Librettos zu sprechen – was diesen zu einem höchst aufschlussreichen Aufsatz inspirierte –, sondern vor allem, weil die musikalische und die szenische Realisierung in geradezu glückhafter Kongruenz und in eindrucksvoller Dichte vorführen, was Schumann im Bereich der deutschen Oper im Sinn hatte. Und da denkt man gern an Harnoncourts Bonmot, dass Wagner großes Glück gehabt habe, weil Schumann so früh gestorben sei.
Dass das Schumann’sche Musikdrama sich zur Gänze aus der Klangwelt und nicht aus einer äußeren Handlung speist, dass die Musik nicht der Untermalung einer solchen Handlung diesen, sondern das Seelenleben der Protagonisten bis in geheimste Regungen ausdeuten soll, ist ein Ansatz von atemberaubender Modernität, der Wagners Ideentheater insofern in den Schatten stellt, als er Freuds Erkenntnisse Jahrzehnte im Voraus sinnlich erfahrbar macht. Und auf diesen Einsichten beruht das kluge, sparsame Regiekonzept Kušejs, der sich von Rolf Glittenberg einen weißen Einheitsraum bauen ließ. Ein Sessel und ein Waschbecken sind die einzigen Versatzstücke in diesem von Realismus abgehobenen Seelenkabinett, in dem die vier Hauptpersonen fast ununterbrochen anwesend sind und in einem genau definierten Kanon ritualisierter Bewegungen agieren – schicksalhaft miteinander verkettete Figuren, die als komplementäre Teile einer Gesamtpersönlichkeit zu lesen sind. Die nahezu überirdische Reinheit der Genoveva wird kontrapunktiert durch die mit Zauberei und Sexualität konnotierte Amme Margaretha, der phantasielose, pflichtgetreue Ehemann Siegfried hat seinen Gegenpol im genial begabten jungen Golo, der sich mit seiner verbotenen Liebe zu Genoveva auf das Schrecklichste schuldig macht und – so Harnoncourts Deutung – im Selbstmord endet. Dazu kommt, als dramaturgische Schlüssel- und Operfigur, der Haushofmeister Drago, der in Kušejs Interpretation stark aufgewertet ist.
Dass dieses Konzept so einfach und schlüssig „aufgeht“, ist den hervorragenden Darstellern zu danken – wobei sich Juliane Banse als begnadete Singschauspielerin entpuppt, die die heikle Titelpartie nicht nur stimmlich, sondern auch im körperlichen und mimischen Ausdruck auf geradezu ideale Weise gestaltet. Daneben überzeugen Tenor Shawn Mathey als unheilvoller, von Leidenschaft getriebener Golo mit vorzüglicher deutscher Diktion und Martin Gantner als schönstimmiger Siegfried von „deutschem“ Schrot und Korn. Cornelia Kallisch gibt eine gefährlich leuchtende Margaretha, und Alfred Muff verleiht dem Drago komturhaftes Format. Der junge Bariton Ruben Drole zeigt als wichtigtuerischer Bischof Hidulfus ein weiteres großes Talent.
Den extremen Ansprüchen, die Schumann an das Orchester und den für die Geschichte sehr wichtigen Chor stellt, sind das Chamber Orchestra of Europe und der Arnold Schoenberg Chor für die CD-Aufnahme mit größerer Souveränität gerecht geworden als die doch etwas überforderten Kollektive des Zürcher Opernhauses; namentlich der Chor rauft merklich mit den zum Teil recht ungewöhnlichen Tempi Harnoncourts. Doch angesichts dieser so gelungenen Ehrenrettung für ein so viel geschmähtes Werk sollen diese Einwände nicht überbewertet werden. Schumann klingt, und er klingt herrlich!