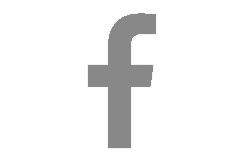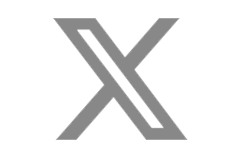Edelstahl wo andere Blumen streuen
Nikolaus Harnoncourt und Martin Kusej machen Schumann «Genoveva» in Zürich zum theatralischen Ereignis.
Opernwelt
Das internationale Opernmagazin
Nr. 4, 2008
Von Uwe Schweikert
Neben und nach Wagner hatten es alle deutschen Opernkomponisten schwer. Auch für Parteigänger wie Peter Cornelius und Hugo Wolf blieb nur die Nische des musikalischen Lustspiels reserviert. Und Sinfoniker wie Brahms, Bruckner und selbst der als Operndirigent höchst erfahrene Mahler sind dem Musiktheater konsequent ausgewichen. Allein Schumann hat Wagner auf diesem Feld herausgefordert. Seine einzige Oper «Genoveva» hatte 1850, im selben Jahr wie «Lohengrin», ihre Premiere. Während die Mär vom Schwanenritter schnell zu einem der erfolgreichsten Werke Wagners wurde, brachte es Schumanns Bühnenversuch nach der zurückhaltend aufgenommenen Leipziger Uraufführung nur auf zwei weitere Vorstellungen. Das Odium des Misserfolgs, ja des Misslingens haftet dem Werk bis heute an. Seine Musik gilt, seit Eduard Hanslicks Verdikt, als undramatisch.
Am entschiedensten hat diesem (Vor-)Urteil in jüngster Zeit Nikolaus Harnoncourt widersprochen. Für ihn ist «Genoveva» die bedeutendste Opernkomposition aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie sei, so hat er mehrfach geäußert, nichts Geringeres als eine «Neuerfindung der Oper». Schumanns imaginäre Bühne der Musik bildet Handlung nicht ab, sondern begleitet das äußere Geschehen in Form eines inwendigen Kommentars. Der Intrigenmechanismus – Golo liebt Genoveva, wird von ihr zurückgewiesen und rächt sich, indem er ein Lügengespinst wirkt, das die stille Dulderin als Ehebrecherin entlarven soll – ist nur der Vorwand einer freudianischen Seelenanalyse mit musikalischen Mitteln.
Es war, nach zwei konzertanten Aufführungen und einer CD-Produktion, Harnoncourts Wunsch, «Genoveva» auf die Bühne zu bringen. Das Opernhaus Zürich, dem er seit fast drei Jahrzehnten verbunden ist, hat ihm diesen Lebenstraum erfüllt. Dass es wirklich eine Erfüllung wurde, dafür sorgte die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin Kusej, der zuletzt meist glücklos agierte, sich hier aber, Hand in Hand mit Harnoncourt, auf radikale wie bestechend genaue Weise auf das Stück und seine musikalische Dramaturgie einließ.
Kusej entziffert die vier Hauptfiguren – zu Genoveva und Golo treten noch die Hexe Margaretha und der biedere Pfalzgraf Siegfried, Genovevas Mann – als die veschiedenen Facetten eines einzigen komplexen Charakters, nämlich Golos. Zu Recht setzt er die pathologische Charakterstudie des haltlosen, sentimentalisch-intellektuellen Verführers in enge Verbindung zu Schumann selbst, der sich mit dem schwankenden, dunkel-verrätselten Wesen seines Anti-Helden identifizierte und in ihm «ein Stück Lebensgeschichte» sah. Das psychologische Netz, das die Musik mit ihrem allwissenden Orchesterkommentar um die zwanghafte Personenkonstellation wirft, erweist sich bei Kusej als psychiatrische Versuchsanordnung (wobei man an Schumanns persönliches Schicksal denken darf, aber nicht muss). Auf die vollständig mit schwarzem Holz ausgekleidete Bühne ließ er sich von rolf Glittenberg einen kleinen Guckkasten bauen: eine fensterlose Zelle von gleißender, fast schmerzender Helligkeit, realer Schauplatz und zugleich das Innere von Golo, in dessen Kopf die Familienaufstellung mit all ihren wahnhaften Zerrüttungen sich abspielt. Die Requisiten sind auf ein Minimum reduziert – ein Sessel, in der Mitte eine Doppeltür (die auch als Versteck dient), rechts ein Lavabo mit Spiegel, im Übrigen aber nackte weiße Wände, die mehr und mehr mit dem verschmiert werden, was die vier zwanghaft in diesen Raum Eingeschlossenen umtreibt: Blut und Dreck. Mit im Spiel: ein glitschiger Fisch, den sie schließlich im Waschbecken entsorgen, Zeichen einer ins Unterbewusste abgedrängten, weil nicht wirklich domestizierbaren obsessiven Sexualität.
Kusej holt die Geschichte aus der Bilderbuchwelt der Ritterromantik und verhandelt mit ihr die Neurosen von Schumanns Zeit, die auch noch die unseren sind. Die Gänge, Gesten, Bewegungen, Verrenkungen, mit der die ständig auf der Bühne anwesenden Hauptfiguren einander umschleichen, verfolgen, einkreisen, aus dem Wege gehen oder autistisch in sich zurückziehen, bedienen sich der Exzentrik klinischer Krankheitsbilder, wie sie schon die Psychiatrie der Schumann-Zeit beschrieben hat. In ihrer beklemmend ausagierten, die Figuren gleichsam zu Somnambulen, zu Gefangenen ihrer Traumata stilisierenden Choreografie erinnern sie an Tanztheater. Man hält den Atem an, wenn Siegfried Genoveva beim Abschied gedankenlos küsst, sie wankt und er auf die Uhr blickt – ein mechanisch sich wiederholender Vorgang, der am Ende, nach der Rettung, wiederkehrt. Oder wenn Genoveva singend über das Waschbecken steigt, das später zum gespenstischen Ort wird, wenn der tote Drago wie ein Widergänger von Mozarts Komtur als Menetekel aus einem zersplitterten Spiegel tritt.
Dieser Innenwelt entgegengesetzt ist die Außenwelt der dunklen, schwarzen Bühne, der Aktionsraum des Chors, der von dort immer wieder in die weiße Zelle eindringt. Bei Kusej ist das Volk kein andächtig betendes und singendes Kollektiv, sondern eine dumpf-erregte Masse – Soldaten und Bauern, mit Stoßgewehren und Beilen bewaffnet, teils an die Kämpfer der 1848er-Revolution, teils an Anstaltsinsassen erinnernd: Pöbel, der jedem Aufruf folgt, egal gegen wen es geht.
Das Ende gleicht, wie der Beginn, einer Implosion: Während Golo an der Wand in sich zusammensinkt, nimmt Siegfried die knapp dem Tod entronnene Genoveva genau so abweisend in Empfang, wie er sich von ihr verabschiedet hatte. Und befremdlich ist selbst das von Kusej zu Recht verweigerte Happy End: Genoveva kniet als leibhaftige Madonna, während der Chor die Anstaltszelle mit Marienfiguren zumüllt. Jedenfalls behält am Ende das Unheimliche und Dunkle der Geschichte das letzte Wort.
Diese szenische Sicht geht auf, weil auch Harnoncourt das Brüchige, Hohle, Gewaltsame in Schumanns Musik hervorhebt. Bedächtig, ja oftmals geradezu stockend und wie in sich hinein (jedenfalls in deutlich langsameren Tempi als auf seiner CD-Einspielung) artikuliert er Gestus und Tempo, schärft die Reibungen von Harmonik und Instrumentation (vor allem im zweiten und dritten Akt) bis zum Grellen, Grotesken, so dass man sich immer wieder an die Klangfarbenkunst eines Berlioz erinnert fühlt, die ja schon dem jungen Schumann nicht fremd war. Nicht zuletzt entdeckt Harnoncourt in der scheinbaren Antidramatik eine nach innen gewendete, jedem Biedermeier-Idyll widersprechende Spannung, so dass man das Stück wie neu, wie befreit erlebt.
Zu diesem Eindruck tragen auch die präzis agierenden Solisten bei, allen voran Shawn Mathey, der mit schlankem, hellem Tenor ein eindrucksvolles Porträt des an seiner Gehemmtheit zerbrechenden Golo gibt. Martin Gantner singt mit kühler Beherrschtheit den fahrigen, nicht weniger als Golo in seiner Männlichkeit gestörten Siegfried. Juliane Banse verkörpert die stille Dulderin Genoveva mit großer Überzeugungskraft. «Musikalisch gesehen», so Franz Liszt über die Rolle, «ist sie die Schwester Fidelios, aber es fehlt ihr die Pistole der Leonore.» Indem Banse die Somnambule zeigt, ja vorführt, jedenfalls nicht identifikatorisch verdoppelt, vermittelt sie zugleich etwas von der Kraft des diagnostischen Blicks, der die Aufführung trägt. Szenisch überzeugend, trotz leichter stimmlicher Ermüdungserscheinungen, Cornelia Kallisch als Margaretha, markerschütternd der Drago von Alfred Muff.
Hebbel, an dessen Version sich Schumanns Libretto weit stärker als an die Volksbuchüberlieferung und an Tiecks romantisches Lesedrama anschließt, hat über sein Drama gesagt, es böte «Edelstahl, wo andre Blumen streuen». An diese Maxime haben Kusej und Harnoncourt sich gehalten, das allein schon sichert ihnen höchste Bewunderung. Man darf gespannt sein, wer nun als Nächster seinen Namen für dieses Stück in den Ring wirft!
Schumann: Genoveva.
Premiere am 17. Februar 2008.
Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt, Inszenierung: Martin Kusej, Bühnenbild: Rolf Glittenberg, Kostüme: Heidi Hackl, Chöre: Ernst Raffelsberger.
Solisten: Juliane Banse (Genoveva), Shawn Mathey (Golo), Martin Gantner (Siegfried), Cornelia Kallisch (Margaretha), Alfred Muff (Drago), Ruben Drole (Hidulfus), tomasz Slawinski (Balthasar), Matthew Leigh (Caspar).
Opernwelt
Das internationale Opernmagazin
Nr. 4, 2008