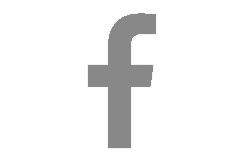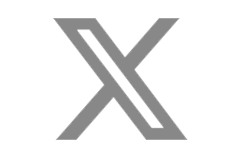Die Gatten: Schlafwandler
Eine Ehrenrettung: Harnoncourt und Kusej mit Schumanns "Genoveva" in Zürich
VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH (Frankfurter Rundschau, 20. 02. 2008)
Sagen wir's gleich: "Genoveva" ist das Werk eines Meisters, aber nicht rundum ein Meisterwerk. Ein Schmerzenskind der Opernbühne, mehr gescholten als gelobt und wenig gekannt. Klar, dass Nikolaus Harnoncourt, goldgräberisch bis weit ins 19. Musikjahrhundert schürfend, diese Robert-Schumann-Rarität einmal im Theater dirigieren wollte. Das Zürcher Opernhaus gab ihm jetzt gediegen Gelegenheit dazu.
Für ihn sicher ein Liebesfall. In der langsamen Ouvertüreneinleitung, beinahe senza tempo avisiert, entdeckte Harnoncourt das Anarchische, Brodelnde, das Gefühls-Magma einer sich von klassischen Vorbildern freischlagenden Klangsprache. Jähe Ausbrüche, im Vagen verebbend. Umso resoluter dann das Allegro, dessen Horn-Seitenthema kaum romantisch-freundlich grüßte, eher drohend kriegerisch ertönte.
Insgesamt hatte die musikalische Diktion (auch bei den vorzüglichen Chor- und Orchester-Formationen) nichts Biedermeierlich-Gemütliches, sondern wirkte aufgeraut, grell, manchmal geradezu derb. Burleske und groteske Episoden wurden durch lärmig- bizarre Intonationen (schrill pfeifende Pikkoloflöten zum Beispiel) angeschärft. Lyrische Feinnuancierung geschah vor allem als Aureole der Titelfigur. Kein Zweifel, es lag Harnoncourt im Sinn, den vehementen Atem, die dramatische Schlagkraft in Schumanns Musik glaubwürdig zu demonstrieren. Das gelang.
Das Werk eines Meisters: Verwunderlich, wenn der Komponist ausgerechnet bei diesem gewichtigen Projekt nicht sein Bestes gegeben hätte. Überzeugend der musikalische Sog der vier Akte, die manches quasi für sich stehend Liedhaftes, Idyllisches, Charakteristisches enthalten, aber nach dem Ende zu jeweils sich verdichten, so dass Schumann wirkungsvolle Abschlüsse oder groß angelegte Ensemblefinali nicht schuldig bleibt.
Auch die Beredtheit, Beweglichkeit der orchesterbegleiteten Rezitativstrecken lässt sich nicht leugnen. Noch im "Lohengrin" gibt es mehr rezitativisches Dürrholz. In der Jahrhundertmitte figuriert "Genoveva" mithin als eine keineswegs anachronistisch-antiquierte Oper.
Tut die Fama dem Stück also gänzlich Unrecht? Mir scheint: Ja, was die ersten drei Akte betrifft. Eine größere Schwäche wird ganz am Ende offenbar. Noch nicht bei dem vorletzten Chortableau, das ein wenig verhangen und fahl daherkommt.
Wohl aber bei der versöhnlich und apotheotisch gemeinten Schlusswendung mit viel "Heil, Heil"-Geschrei und einem nun wirklich ins Schale sich ernüchternden affirmativen Jubelgestus. Vielleicht ehrt es Schumann, dass er an dieser Stelle der visonären Abflachung seines Stoffes erliegt. Vorgeschwebt mag ihm die Hinleitung eines Gattendramas in reines Glück à la "Fidelio" haben, aber das gibt das Sujet nicht her.
Die Legende aus der Kreuzzugszeit (am Libretto wirkte der Komponist mit, nicht ganz auf dem Niveau seiner literarischen Zuständigkeit) ist unübersehbar kontaminiert von Patriarchats-Moral, geht es doch um die Prüfung der Gattinnentreue.
In Abwesenheit des Ehemannes Siegfried versucht Golo, die angebetete Genoveva für sich zu gewinnen; nach seiner Abweisung verstrickt er sie in eine beinahe tödliche Intrige. Der zurückgekehrte Siegfried ist es, der schließlich Genovevas Unschuld erkennt, seine richterliche Gewalt ins Gnädige wendet und die Ehe rettet. Ehrenrettung, Eherettung?
Nein, so ganz retten ohne faden Beigeschmack lässt sich dieser Plot nicht, wenn man ihn allzu wörtlich nimmt. Das tut der Regisseur Martin Kusej mitnichten, indem er das Werk dekonstruktivistisch analysiert und dabei erstaunliche psychologische Ambivalenzen aufdeckt.
Rolf Glittenberg baute als Spielort einen in strahlendem Weiß gehaltenen Kasten (an dessen Rändern der Chor, ein mehr rurales als ritterliches Kollektiv mit atavistischen Waffen, aus gleichsam mythischem Dunkel hervorquillt). Die überwiegend schwarz gekleideten Personen (Kostüme: Heike Hackl) bewegen sich in diesem Seelenraum (vor der Ouvertüre und zu den Aktanfängen auch ohne Musik) wie Schlafwandler. Sie spielen mehr für sich als miteinander.
Rätselhafte Verrichtungen, auffällig ritualisierte Zwangshandlungen. Vielmals geht Genoveva wie somnambul auf Siegfried zu, um, bei ihm stehend, in eine Ohnmacht zu fallen, wobei sie sich jedesmal noch knapp fängt.
Die heile Welt der Ehe gibt es in dieser Optik also nicht. Schumann und Clara, wohl eher eine gequälte Partnerschaft. Zum fahlen vorletzten Chor markiert Kusej die Sakralisierung Genovevas durch eine Masse auf der Bühne aufgestellter Heiligenstatuetten. Zum allerletzten Finale fällt ihm dann aber auch nichts mehr ein. Warum sollte er das auch interpretatorisch verschmieren? Die Richtigkeit der Darstellung riskierte triftig das Brüchige der Handlung.
Es gab durchweg bewundernswerte sängerdarstellerische Leistungen. Golo, unkonventionellerweise eine Tenorpartie, wurde von Shawn Mathey differenziert als "gemischter" Charakter angelegt. Lyrische Facetten konnte er in dem einer Volksweise nachempfundenen "Wenn ich ein Vöglein wär" (2. Akt) präsentieren, fast einem Liebesduett. Fast martialisch finster war die hexenhafte Margaretha von Cornelia Kallisch koloriert.
Etwas aufgehellter, aber wunderbar samtig und sanft das Genoveva-Timbre von Julia Banse, in das einige Spitzentöne (minuziös gemeistert) leidenschaftlich eingelegt waren wie Intarsien. Die Autoristätsperson Siegfried, hier eher ein falscher Fuffziger, wurde von Martrin Gantner vokal groß formatiert. Viel Premierenapplaus mit einigen Buhs für Kusej, dem biedere Zürcher wohl eine angedeutete Fellatio übelnahmen.