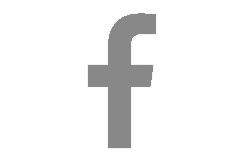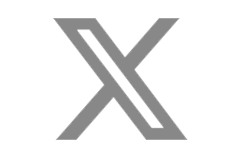Robert Schumann Liederkreis
Zwölf Gesänge von J. von Eichendorff
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
Op. 39
Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno
Nachwort
Schumanns Liederkreis nach Eichendorff-Gedichten op. 39 ist einer der großen lyrischen Zyklen der Musik. Diese bilden, seit Schuberts Müllerliedern und der Winterreise bis zu den Georgeliedern op. 15 von Schönberg, eine eigentümliche Form, welche die Gefahr allen Liedwesens, die Verniedlichung der Musik in genrehafte Kleinformate, bannt durch Konstruktion: das Ganze steigt aus dem Zusammenhang miniaturhafter Elemente auf. Der Rang des Schumannschen Zyklus ward so wenig je in Zweifel gezogen wie sein Zusammenhang mit der glücklichen Wahl großer Dichtung. Viele der bedeutendsten Eichendorff-Verse sind darunter, und die wenigen anderen haben durch besondere Eigentümlichkeiten die Komposition inspiriert. Mit Grund nennt man die Lieder kongenial. Das heißt aber nicht, daß sie den lyrischen Gehalt ihres Vorwurfs bloß wiederholten; dann wären sie, nach höchster künstlerischer Ökonomie, überflüssig. Sondern sie bringen ein Potential der Gedichte heraus, jene Transzendenz zum Gesang, die entspringt in der Bewegung über alles bildhaft und begrifflich Bestimmte hinweg, im Rauschen des Wortgefälles. Die Kürze der gewählten Texte – keine Komposition außer der gleichsam exterritorialen dritten ist von größerer Ausdehnung – erlaubt jeder einzelnen äußerste Präzision und schließt mechanische Wiederholung vorweg aus. Meist handelt es sich um variierte Strophenlieder, zuweilen um dreiteilige Liedformen nach dem Grundriß a-b-a, einigemale auch um ganz unkonventionelle, in einen Abgesang mündende Formen. Die Charaktere sind aufs genaueste gegeneinander ausgewogen, sei es durchs Mittel sich steigernder Kontraste, sei es durch verbindende Übergänge. Gerade die Profiliertheit der einzelnen Charaktere macht aber den Plan des Ganzen notwendig, wenn es nicht in Details sich zersplittern soll; die unausrottbare Frage, ob ein solcher Plan dem Komponisten bewußt war, ist gleichgültig gegenüber dem Komponierten. Wird immer wieder von Schumanns Formalismus geredet, so mag etwas daran sein, solange es um die überlieferten und ihm bereits entfremdeten Formen sich handelt; wo er sich eigene schafft, wie in seinen früheren Instrumental- und Vokalzyklen, bewährt er nicht nur den subtilsten Formsinn sondern obendrein einen von äußerster Originalität. Alban Berg hat, in seiner exemplarischen Analyse der Träumerei und ihrer Stellung in den Kinderszenen, zum erstenmal, zwingend, darauf aufmerksam gemacht. Der Aufbau der Eichendorfflieder, in vielem den Kinderszenen verwandt, erheischt ähnliche Einsicht, wenn man über die bloß wiederholende Beteuerung ihrer Schönheit hinausgelangen will.
Jeder Aufbau des Liederkreises steht im engsten Verhältnis zum Gehalt der Texte. Wörtlich ist der von Schumann herrührende Titel Liederkreis zu nehmen: die Folge schließt sich den Tonarten nach zusammen und durchmißt zugleich einen modulatorischen Weg von der Melancholie des ersten, in fis-Moll, zur Ekstase des letzten im Dur des gleichen Tons. Ähnlich wie die Kinderszenen ist das Ganze zweiteilig gegliedert, und zwar im einfachsten Symmetrieverhältnis, mit der Zäsur nach dem sechsten Lied. Sie wäre durch ein deutliches Absetzen zu markieren. Das letzte Lied des ersten Teils, Schöne Fremde, steht in H-Dur, mit entschiedenem Aufstieg in die Dominanzregion; das letzte des gesamten Zyklus, in Fis-Dur, führt diesen Aufstieg noch um eine Quint weiter. Dies architektonische Verhältnis drückt ein poetisches aus: das sechste Lied endet mit der Utopie des künftigen großen Glücks; mit Ahnung; das letzte, die Frühlingsnacht mit dem Jubel: ›Sie ist Deine, sie ist Dein‹, mit Gegenwart. Verstärkt wird die Zäsur durch den Tonartenplan. Während die Lieder des ersten Teils allesamt in Kreuztonarten geschrieben sind, senken sie sich zu Beginn des zweiten Teils zweimal nach a-Moll, ohne Vorzeichen, um dann im ersten Teil vorwaltenden Tonarten reprisenhaft wieder aufzunehmen, bis die Anfangstonart erreicht und zugleich mit der Versetzung in Dur die stärkste modulatorische Steigerung bewirkt wird. Die Folge der Tonarten ist bis ins einzelne balanciert; das zweite Lied bringt die Dur-Parallele zum ersten, das dritte deren Dominante; das vierte senkt sich ins terzverwandte G-Dur, das fünfte stellt das vorausgehende E-Dur wieder her, und das sechste erhebt sich weiter nach H-Dur. Von den beiden a-moll-Liedern des zweiten Teils schließt das erste auf einen Dominantakkord, der das Gedächtnis an E-Dur wachruft; das anschließende, In der Fremde, anstatt in a-moll in A-Dur, das folgende erreicht dann wiederum E-Dur als Dominanz-Tonart von A-Dur, analog dem architektonischen Verhältnis des dritten zum zweiten. Ähnlich korrespondiert das zehnte, in e-moll, dem vierten in G-Dur, beide in Tonarten mit nur einem Kreuz. Anstelle des E-Dur des fünften jedoch bringt das elfte nur A-Dur und verleiht dadurch dem Übergang in die extreme Tonart, Fis-Dur, mit der großen Spannung allen modulatorischen Nachdruck. –
Diese harmonischen Proportionen vermitteln die innere Form des Zyklus. Er beginnt also mit zwei lyrischen Stücken, traurig das eine, im abgerungen fröhlichen Ton das zweite. Das dritte, Waldesgespräch, die Loreleiballade, konstratiert ebenso durch den erzählenden Ton wie durch die breitere Anlage und den doppelstrophischen Bau; im ersten Teil nimmt es eine ähnliche Sonderstellung ein wie dann im zweiten die an analoger Stelle lokalisierte Wehmut. Das vierte und fünfte Lied wenden sich zum intimen Charakter zurück, steigern aber dessen Zartheit; Die Stille ein piano-, die Mondnacht ein pianissimo-Lied. Das sechste, die Schöne Fremde, bringt den ersten großen Ausbruch. Der zweite Teil wird eröffnet von einem Stück zwischen Lied und Ballade, und auch das folgende gibt den lyrischen Ausdruck im Medium des Erzählens. Die Wehmut dann ist formal ein Intermezzo wie zuvor das Waldesgespräch, nun aber lyrisch ganz und gar, gleichsam die Selbstreflexion des Zyklus. Das zehnte Lied, Zwielicht, erreicht, wie das Gedicht es verlangt, den Schwerpunkt des Ganzen, die tiefste, dunkelste Stelle des Gefühls. Es zittert nach im elften, der Jagdvision Im Walde. Darauf endlich, mit dem stärksten Kontrast des gesamten Zyklus, die Elevation der Frühlingsnacht. –
Zu den einzelnen Liedern mag so viel bemerkt sein: das erste, In der Heimat hinter den Blitzen rot, ist ›Nicht schnell‹ überschrieben und wird darum stets zu langsam genommen; man muß es in ruhigen Halben, nicht in Vierteln denken. Auffallend vorab die dissonierenden Akkordakzente; der kurze Mittelteil kennt ein bleich schimmerndes Dur, mit kurzen Motivansätzen im Klavier; eine unbeschreiblich ausdrucksvolle harmonische Variante fällt auf die Worte ›Da ruhe ich auch‹. Innerhalb der Gesamtform des Zyklus erfüllt das Lied einleitende Funktion. Es geht melodisch noch nicht aus sich heraus, hält meist mit Sekundintervallen haus. – Das zweite Lied, Dein Bildnis wunderselig, am ehesten Schumanns Heinegesängen vergleichbar, hat einen drängenden Mittelteil, dessen Impuls von der Reprise nach Hause gebracht wird. Diese beginnt mit einer Dehnung der Dominante, unter Aussparung der Tonika, so daß der harmonische Strom über den Formeinschnitt hinwegfließt. Abermals gibt es Ansätze selbständiger Nebenstimmen, eine Art hingetuschten harmonischen Kontrapunkts, der für den Stil des ganzen Werkes charakteristisch ist; folgerecht arbeitet dann auch das Nachspiel mit Imitationen des Themas durch seine Gegenbewegung. – Das Waldesgespräch ist eines jener Schumannmodelle, aus denen Brahms entsprang. Die Form bildet der Kontrast des Balladenberichts und der Geisterstimme. Musikalisch am originellsten sind die zwiespältigen alterierten Akkorde, welche die drohende Lockung ausdrücken. – Das vierte, ganz vor sich hingesungene Lied bricht in der Mitte jäh aus und nimmt sogleich ins Leise sich zurück. Zum Wort ›wissen‹ wird ein quartiger Akkord angeschlagen, der, durch doppelte Vorhaltsbildung, gefärbt ist wie vom Triangel. – Von der Mondnacht läßt so schwer sich reden, wie, nach Goethes Diktum, von allem, was eine große Wirkung getan hat. Doch darf bei der Komposition, der tongewordenen Klarheit, wenigstens auf Züge verwiesen werden, durch die sie der Monotonie entgeht, wie die hinzugefügte Sekundreibung in der zweiten Strophe bei den Worten ›durch die Felder‹. Sigel des Liedes ist der große Nonenakkord, mit dem es anhebt. Durch die Setzweise und seine figurative Auflösung hält er sich diesseits des Schwelgerischen, das er vielfach bei Wagner, Strauss und später annimmt. Vielmehr suggerieren die übereinander geschichteten Terzen das Gefühl des Gedichts, indem das Ohr dieselben Intervalle wie ins Unendliche fortsetzt, über das real Erklingende hinaus, während zugleich die Identität des Terzenintervalls eben jene Klarheit rettet, aus deren Verhältnis zum Unendlichen der Ton des Liedes resultiert. Die Form nähert sich dem Bar; die letzte Strophe zeichnet als Abgesang die ausgreifende Gebärde des Gedichts nach, während doch die beiden letzten Zeilen Reprise des Beginns bleiben und das transzendierende Gebilde wiederum in sich verschließen. Der rhythmischen Dehnung zu den Schlußworten ›Als flöge sie nach Haus‹, wo aus zwei Dreiachteltakten ein großer Dreivierteltakt wird, dürfte kein Ohr sich versagen, das sie einmal wahrgenommen hat. Dies auskomponierte Ritardando hat ein Brahmsisches Verfahren gezeitigt, das endlich die bei Schumann unbestrittene Vorherrschaft der achttaktigen Periode bracht. – Die Schöne Fremde setzt auf der dritten Stufe ein, gewissermaßen in schwebender Tonalität, so daß das H-Dur des ekstatischen Schlusses wirkt, als wäre es nicht vorweg da, sondern aus dem Gang der Melodie erst erzeugt; das Wort ›phantastisch‹ spiegelt sich in einer süß eindringenden Dissonanz. Ach hier hat die Schlußstrophe deutlich das Wesen des Abgesangs; aber in dem Lied ist insgesamt auf Symmetrie durch Wiederholung verzichtet, es strömt mit wahrhaft unerhörter Freiheit dorthin, wo es melodisch und harmonisch hinaus will.
Auf einer Burg, das ritterromantische Stück, mit dem der zweite Teil anhebt, wird ausgezeichnet durch die kühnen, bei Schumann und im früheren neunzehnten Jahrhundert wohl einzigartigen Dissonanzen, die aus dem Zusammenstoß der melodischen Linie mit den choralhaften Bindungen der an Nebenstufen reichen Begleitung resultieren; es ist, als hätte die Modernität dieser Harmonisierung vorweg das Gedicht vorm Veralten schützen wollen. – Das gedämpft hastende ›Ich hör die Bächlein rauschen‹ ist aus einfachsten Zweitaktern, ohne jede rhythmische Variation gefügt, aber mit derart expressiven harmonischen Nuancen und, am Schluß, einem so grellen Akzent, daß gleichwohl die wildeste Rührung davon ausgeht. – Das Adagio-Intermezzo Wehmut hält sich im undurchbrochenen Legatosatz harmonischer Instrumentalstimmen; die modulatorische Ausweichung in die Unterdominanzregion beim Wort ›Sehnsucht‹ läßt jedoch darauf eine Sekunde lang schräg, wie von außen, trübsinniges Licht fallen; gegen das angedeutete D-Dur scheint die Haupttonart E-Dur kränklich aufzuleuchten. – Zwielicht, vielleicht das großartigste Stück des Zyklus, der Form nach einfaches Strophenlied, ist als starker Kontrast zum vorhergehenden kontrapunktisch, mit jener unendlich produktiven Umdeutung Bachs, an der der Historismus sich stößt, während also verwandelt Bach wahrhaft nachlebt. Das umgedachte Vorbild ist wohl das Thema der h-moll-Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers. Das c im Kontrapunkt des zweiten Takts, aus der harmonischen Molltonleiter gewonnen, hat eine Art von Schwere, die dann dem Ganzen, horizontal und vertikal, sich mitteilt, die ganze Musik in die Tiefe hinunterzieht. Die erste und zweite Strophe endet im dunklen Ton eines lang hallenden Akkords, als tönte das Lied in einem hohlen Raum; die dritte, ›Hast du einen Freund hinnieden‹, verdichtet das kontrapunktische Gewebe durch Hinzufügung einer dritten selbständigen Stimme; die vierte schließlich vereinfacht das Lied, bei identischer Melodie, ins Homophone und faßt die merkwürdige letzte Zeile, ›Hüte dich, sei wach und munter‹, aufs knappste, rezitativisch. – Das folgende Lied, Im Walde, wird erzeugt aus der anschlagenden Tonwiederholung des Horns und dem immer wiederkehrenden Gegensatz von Ritardando und a tempo, der übrigens der Darstellung außerordentliche Schwierigkeiten bereitet. Schumanns Formsinn triumphiert darin, daß er, gleichsam um die hartnäckig retardierenden Momente auszugleichen, einen fast widerstandslos gleitenden und gerade dadurch höchst unheimlichen Abgesang schreibt, der doch stets den Hornrhythmus markiert bis in die beiden letzten Noten der Singstimme hinein. – Die Frühlingsnacht endlich, berühmt wie nur ›Es war, als hätt‘ der Himmel‹, scheint so sehr aus einem Guß, als spottete sie des analytischen Blicks; aber ihre Einheit wird gerade von der vielfältigen Artikulation des gedrängten Verlaufs erzeugt. Analog zur Mondnacht ist die Idee des Liedes – hier die des hingerissen über sich Hinausgreifenden – im Ausgangsmaterial implizit. Die Melodie hat zum Kern einen umschriebenen Septim-Akkord. Melodisch prägnant an ihm ist das Septimintervall, dessen Schwung die Dreiklangsterzen und Sekundfüllungen überfliegt und das, in einem sonst von diesen definierten kompositorischen Raum, einer Subjektivität zur Sprache verhilft, die der Fessel sich entledigt. Schumanns Ingenium hat es jedoch nicht bei der Affektensymbolik belassen, sondern das kritische Intervall der Septime strukturell ins Zentrum gerückt. Angedeutet wird es schon in der Aufeinanderfolge der Phrasenendungen und –anfänge bei ›Jauchzen möchte‘ ich, möchte weinen‹; bei dem Wort ›Sterne‹ erfaßt es die Singstimme, und schließlich, vor ›Sie ist Deine‹, wird es von der Begleitphrase des Klaviers variiert, so daß der motivische Verlauf identisch ist mit der Gefühlskurve. Das Lied des äußersten Ausbruchs ist ein piano-Lied, nach jeder Welle zum leisen Grunde zurückkehrend, und nur dem verdankt es das Atemlose, das erste im Forte der beiden Zeilen sich entlädt. Der Mittelsatz ›Jauchen möchte‘ ich, möchte weinen‹ setzt zu der jagenden Akkordbegleitung eine abermals nur eben angedeutete Gegenstimme, ohne daß doch die Bewegung unterbrochen würde. Das Atemlose steigert sich aufs höchste dort, wo, vor den Worten ›Mit dem Mondesglanz herein‹, ein guter Taktteil ganz ausgespart ist. Die Wiederholung der ersten Strophe führt zur Klimax nicht nur durch die harmonischen und melodischen Varianten, sondern dadurch, daß an der entscheidenden Stelle der Kontrapunkt des Mittelteils, nun erst ganz frei und erfüllend, hinzugefügt wird, und ins Nachspiel hinüberträgt, in dem dies Motiv, der wahre Jubel, alles andere vergessen hinter sich zurückläßt.
Theodor W. Adorno
Aus: Robert Schumann. Liederkreis. Zwölf Gesänge von J. von Eichendorff für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte op. 39
Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno
Erschienen im Insel-Verlag, Wiesbaden 1960, S. 68 – 75
(Aus dem Buch für das Schumannportal neu abgeschrieben im StadtMuseum Bonn, 2006)