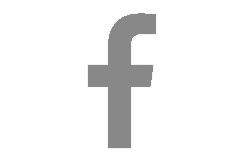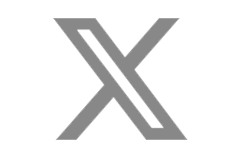George Bernard Shaw zur englischen Erstaufführung von Robert Schumanns Oper „Genoveva“
13. Dezember 1893
Das musikalische Hauptereignis der vergangenen Woche war die englische Erstaufführung von Schumanns „Genoveva“ durch die Schüler des Royal College of Music. Parterre und Ränge des (bei dieser Gelegenheit großzügig zur Verfügung gestellten) Drury Lane Theatre waren gerammelt voll mit Schülern. Überall gab es auch Eltern und Onkel und Tanten von Schülern, welche die Vorstellung an den unmöglichsten Stellen mit übel angebrachtem Beifall unterbrachen und der Meinung waren, eine so unverständliche und feierliche Musik wie die von Schumann müsse wohl ein ausgezeichnetes Bildungsmittel für die Jugend sein. Parkett und Logen strotzten von Kritikern und anderen hervorragenden Persönlichkeiten.
Als eine von ihnen darf ich vielleicht vorschlagen: Wenn wir so zahlreich und daher so eng zusammengedrängt sind, sollte die Direktion in den Zwischenakten einen Dampfkran neben dem Souffleurkasten zur Verfügung stellen, damit ein Kritiker, der in der Pause seinen Platz verlassen möchte, sich mit dem Hosenbund in die Kette einhaken, von seinem Sitz hochgehißt und an der dem Büffet nächstgelegenen Tür wieder heruntergelassen werden könnte.
Das Orchester von gegen achtzig Mitwirkenden war mitverantwortlich für das Gedränge. Es repräsentierte den bei weitem glanzvollsten Teil des Hauses, da nämlich von den fünfzig Streichern fünfunddreißig junge Frauen waren und größtenteils so reizend, daß diesmal das Orchester im Durchschnitt über mehr körperliche Anziehungskraft verfügte als die Bühne. Ihr Durcheinanderschwärmen und Geplapper bei Einnehmen der Plätze und die Art, wie sie ihren Freunden ungeniert mit den Bögen zuwinkten, versetzte jedermann in gute Laune, sogar die Kritiker, die wütend waren, ihre Abendarbeit schon um halb zwei Uhr beginnen zu müssen.
Mit der „Genoveva“ hat das College eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Da das Werk als Oper keinen Handelswert hat, so hätten wir es nie zu hören bekommen, wäre es nicht von einer rein akademischen Institution aufgegriffen worden; da es aber von Schumann ist, mußte sicher ein gutes Stück interessanter Musik darin stecken. Denn Schumann besaß zumindest eine Gabe, die wir heute unter den Eigenschaften eines Bühnenkomponisten sehr hoch einzuschätzen pflegen, nämlich ein starkes Empfinden für Harmonie als gefühlsmäßiges Ausdrucksmittel. Die „Genoveva“ enthält Stellen, die in dieser Hinsicht echter Wagner sind – und ich gehöre nicht zu den Unverbesserlichen, die „Wagner“ rufen, sobald sie einen unvorbereiteten „tonischen Dur-Mißklang“ hören.
Leider bleibt Schumann bezüglich der übrigen Voraussetzungen des Musikdramatikers weit hinter Beethoven zurück, so wie Beethoven hinter Mozart und Wagner zurückbleibt. Zunächst einmal verzichtet er auf allen Anspruch, sein Unternehmen ernst zu bewerten, indem er ihm einen Text gibt, der einfach albern ist. Vielleicht hat er sich eingeredet – eine Torheit, die ihm durchaus entsprochen hätte -, er könnte seine Heldin für seine Oper dasselbe leisten lassen, was Beethoven Leonore für den „Fidelio“ leisten läßt. Aber „Fidelio“ ist zwar flach und grob, jedoch nicht albern. Seine paar harmlosen Bühnentrivialitäten hindern nicht, daß die Oper von Anfang bis zu Ende glaubhaft und menschlich ist, während „Genoveva“ von dem Augenblick, da im ersten Akt die Zauberin auftritt, in reinen Unsinn absinkt und bis zum Schluß größtenteils auf diesem Niveau verharrt. Die Musik der Zauberin ist gehaltlos und halb ernst, halb komisch; das Orchester wächst sich beim Höhepunkt zu einer schandbaren Pikkolopassage aus, die kaum mit bloßem nachsichtigem Gelächter davonkommen würde, wenn sie von einem weniger hochgeschätzten Komponisten stammte.
An einer Stelle bricht der Bösewicht, als er mit der ohnmächtigen Heldin dasteht, in den Ausruf aus: „Wir sind allein.“ Sofort – die Zauberin steht hinter der Ecke – gibt die Pikkoloflöte ein längeres höhnisches Gekreisch von sich, so als wollte ein Kakadu zu verstehen geben, daß ihm nichts entgangen sei. Instrumentation war, wie wir alle wissen, nicht gerade Schumanns starke Seite, und die „Genoveva“ enthält eine Menge seines charakteristischen Orchester-Durcheinanders; aber mir fällt kein anderes Beispiel einer absichtlich albernen Instrumentation ein. Vielleicht ist die Zauberin in den Anfangsszenen nicht viel schlimmer als Sir Arthur Sullivans Ulrica in seiner Oper „Ivanhoe“ und in der Beschwörungsszene nicht schlimmer als Verdis Ulrica im „Maskenball“, aber man braucht nur an Ortrud im „Lohengrin“ zu denken, um sich klarzumachen, wie weit Schumanns unoriginelle Gedanken von denen eines wahrhaft schöpferischen Genies entfernt sind.
Fehlgeschlagen in „Genoveva“ ist auch Golo, der Bösewicht. Da er leider ein sentimentaler Bösewicht ist, so wäre Mozarts Feinheit der Charakterisierung nötig, um ihn von den übrigen sentimentalen Gestalten der Oper zu unterscheiden, von dem Helden und der Heldin zum Beispiel. Diese Feinheit besaß Schumann nicht; dementsprechend könnten Siegfried oder Genoveva ohne das kleinste Missverhältnis jeden Takt von Golos Partie singen. Man stelle sich vor, wie es wäre, wenn Don Giovanni die Partie Leporellos singen würde, Elvira Zerlinens, Wotan Loges und Alberich Mimes!
Selbst Beethoven, dessen Fähigkeiten in dieser Hinsicht so stumpf waren, daß er prokrustesgleich vier verschiedene Personen in seinem „Fidelio“ auf einen Nenner brachte, indem er ein kanonisches Quartett für sie schrieb (man denke sich „Non ti fidar“ oder „Un di si ben“ als Kanon!), ganz abgesehen davon, daß sein Gefängnispförtner und die Tochter des Kerkermeisters musikalisch von seinem Florestan und seiner Leonore völlig ununterscheidbar sind – selbst Beethoven machte aus Pizarro einen unmissverständlichen Halunken. Er hätte uns nicht, wie Wagner oder Mozart, ein halbes Dutzend Halunken geben können, deren jeder sich vom anderen unterschieden hätte wie Tartuffe von Harpagon …, aber wenigstens konnte er doch eine liebenswürdige Figur von einer unliebenswürdigen trennen. Aber für Schumann war diese bescheidene Aufgabe in der „Genoveva“ zuviel.
Wir müssen uns also offenbar, um die Verdienste herauszufinden, welche die Partitur etwa besitzt, an ihre sinfonischen, beschreibenden und lyrischen Seiten halten. Nirgendwo finden wir dort irgend etwas, daß jemand sich anhören müßte, der Schumanns Lieder, Klavierstücke und Sinfonien kennt. In den albernen Zauberspiegel- und Geisterszenen des dritten Akts und der irrsinnigen Angelegenheit in der Schlucht im vierten überlässt Schumann die Bühne meistenteils sich selbst und zieht sich auf reine Sinfonie zurück; der Erfolg ist nur unter der Bedingung erträglich, daß man alles, was auf den Brettern gezeigt wird, als überflüssigen Plunder ignoriert, ausgenommen vielleicht, was gerade noch nötig sein mag, um die Gefühle Genovevas und ihres Gemahl wenigstens andeutungsweise zu motivieren.
Am besten ist die Oper immer, wenn Genoveva auf der Bühne steht, und außer in der Musik der Zauberin ist sie niemals wirklich roh und trivial. Der Abzug der Truppen im ersten Akt ist ein wirksames Stück Bühnenmusik, und im zweiten Akt gibt es ein oder zwei Episoden – wenn Genoveva allein in ihrem Zimmer ist-, die keineswegs misslungen sind. Aber als Ganzes ist das Werk ein Versager, und sosehr ich mich freue, es gehört zu haben, kann ich die Welt nicht verdammen, daß sie ihre Bekanntschaft mit der „Genoveva“ aufgegeben hat, obgleich sie übrigens genügend weniger würdige Namen auf ihrer Opernbesuchsliste stehen ließ.
Die Aufführung unter Leitung von Professor Stanford lief fehlerlos ab. Sie war gewissenhaft und gründlich probiert worden, und die Ausführenden, die unbezahlt und durch Beliebtheit oder praktische Erfahrung mit der Leichtgläubigkeit des harmlosen Untiers Publikum nicht verdorben waren, taten eifrig und begierig ihr Allerbestes. Das Ergebnis war, trotz Hunderter komischer kleiner Zwischenfälle, die durch die Nervosität und das Ungeschick der Instrumentalisten verursacht wurden, eine gewisse Genugtuung und sogar so etwas wie Illusion – was bei gewöhnlichen berufsmäßigen Aufführung nur ganz selten anzutreffen ist.
Der aufdringlichste akademische Teil der Angelegenheit waren Haltung, Gehen und Gebärden. Den unglücklichen Schülern war „Haltung“ beigebracht worden, bis sie nicht mehr wagten, ihre Arme und Beine ihr eigen zu nennen. Der Professor für Haltungsschulung mit seinen Schönheitsprinzipien und seinen Vorschriften zum Erlangen vollkommener Grazie ist beinahe eine ebenso unheilbringende Persönlichkeit wir der Professor der Harmonielehre mit seiner Sammlung von Regeln zur Erzielung „vorschriftsmäßiger“ Stimmführung. Zum Unglück des Professorentums ist keine Haltung unbedingt schön. Apollo sieht vielleicht – acht Köpfe groß und mit breiteren Schultern als Hüften, wie ein Gott in einer Stellung aus, in der Smith – sieben Köpfe groß und mit Hüften, die möglicherweise breiter sind als seine Sektflaschenschultern – lächerlich wirkt.
Man kann noch so viel Schönheitsregeln aus der griechischen Bildhauerei zusammenstoppeln; aber der Bildhauer kann sich die Figur nach der Haltung formen, die sie einnehmen soll, der Schauspieler hingegen muß die Haltung aus der verfügbaren menschlichen Figur beziehen,, und die ist von Person zu Person so verschieden, daß die Methoden zur Identifizierung von Verbrechern nach ihren Körpermaßen, wie es heißt, unfehlbar sind. Da ein sollgroßes Abweichen in der Beziehung zwischen Körpergröße und Beinen und Kopf für die Grazie einer Stellung den gewaltigsten Unterschied bedeuten kann, so ist es nicht verwunderlich, daß Leute, die Haltung und Gebärden anderer nachahmen – besonders, wenn die Vorbilder für ihre Grazie berühmt sind -, sich unfehlbar lächerlich machen. Es gibt eben keine Normalhaltung; das äußerste, was ein Lehrer tun kann, ist, das Bewusstsein des Schülers in der Frage persönlicher Grazie zu wecken und es ihm zu überlassen, daß er dann, von diesem Bewusstsein geleitet, selbst seine Haltung schult.
Für das Schumannportal im Büro des StadtMuseums Bonn neu abgeschrieben aus:
Musikkritiken von G. B. S. aus den Jahren 1890 bis 1894, in:
George Bernard Shaw
Musikfeuilletons des Corno di Bassetto
Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig. 1972, Seite 215-220