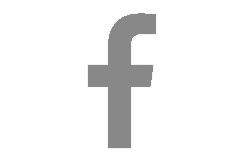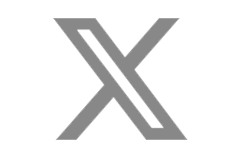Eine dunkle Zeit bekommt ein Gesicht
Neue Musikzeitung
nmz 2006/07 | Seite 46
55. Jahrgang | Jul./Aug.
Der Fall bleibt unabgeschlossen: Robert Schumann in Endenich
Robert Schumann in Endenich (1854–1856) – Krankenakten, Briefzeugnisse und zeitgenössische Berichte, hrsg. v. Bernhard Appel für die Akademie der Künste Berlin und die Robert-Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf (Schumann Forschungen, Bd. 11), Schott-Verlag, Mainz 2006, 607 S., € 34,95, ISBN 3-7957-0527-4
Wohl kaum ein Musiker hat einen so dankbaren Lebensroman abgegeben wie Robert Schumann. Er vor allem gehört zu den Komponisten, denen das zweifelhafte Vergnügen zuteil geworden ist, mehr biographisches als musikalisches Interesse geweckt zu haben. 150 Jahre Schumann-Rezeption sind in dieser Hinsicht durchaus ernüchternd: Nicht nur, dass das Spätwerk einer förmlichen „Rehabilitierung“ bedarf – nach wie vor geistert der „ewige Jüngling“ durch Biographien und Konzertprogramme – nicht nur, dass die 1991 initiierte, historisch-kritische Ausgabe der Kompositionen noch immer im Aufbau begriffen ist – eine überbordende Erinnerungsliteratur der mehr belletristischen Richtung hat sich zudem mit nicht nachlassender Faszination den immer gleichen Themen zugewandt, obwohl oder gerade weil die Quellenlage dürftig und unklar ist: „Schumann in Endenich“ zum Beispiel.
Aus Pietät gegenüber dem tragischen Lebensausgang des Komponisten hat die seriöse Forschung dieses Thema bereits im 19. Jahrhundert den Medizinern, Psychologen und Psychiatern überlassen. Eine freiwillige Selbstbeschränkung, deren Ende definitiv gekommen ist.
Pünktlich zum 150. Todestag hat eine Herausgebergemeinschaft aus Akademie der Künste Berlin und Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf einen gediegenen 600-Seiten-Band vorgelegt.
Flankiert von medizinhistorischen Stellungnahmen und einem umfangreichen Abbildungsteil bringt die Dokumentation neben Briefen und Zeitzeugenberichten den bisher nur in Auszügen zugänglich gewesenen Krankenbericht über Schumanns Endenicher Klinikaufenthalt. Zwischen März 1854 und Juli 1856 haben die behandelnden Ärzte Befinden und Verhalten ihres prominentesten Patienten akribisch protokolliert. „17. April 1854 – Gesichtsausdruck befangen, starr, abwesend, auch grimassirend, die Lippen wie im Gespräch bewegend. Der Kopf sei ihm schwer. [...] Nach dem Clystier 10–12 Knöllchen Ausleerung. Sagte gestern, es sei zu still in seiner Umgebung.“
Jahrzehntelang befand sich dieses Dokument im Besitz des Berliner Komponisten Aribert Reimann. In Güterabwägung zwischen Bindung ans Arztgeheimnis einerseits, Aufklärungsinteresse andererseits, hat der Erbe einer zentralen Schumann-Archivalie schließlich einer Veröffentlichung zugestimmt. Unter die „Spekulationen, Verleumdungen und abenteuerlichen Erfindungen“ zu Schumanns Endenicher Zeit müsse endlich, so Reimann, ein „Schlussstrich“ gezogen werden.
Dass er das Schweigegebot gebrochen hat, ist ihm nicht leicht gefallen. Getröstet wurde Reimann mit einer schönen Idee des Herausgebers Bernhard Appel. In großer Gewissenhaftigkeit hat dieser eine Art Tagebuch kreiert, in dem neben den Ärzten, der Ehefrau, den Freunden und der zeitgenössischen Publizistik auch der Komponist selbst zu Wort kommt. Bis in die mehr als eintausend Fußnoten ist alles sorgfältig ediert, behutsam kommentiert. Auf buchstäblich jeder der 600 Seiten wird das Interesse spürbar, Sachlichkeit in ein hochemotionalisiertes, skandalisiertes Thema hineinzutragen, der „Spekulationsdynamik“, so Appel, den Wind aus den Segeln zu nehmen, Fakten an die Stelle von Fiktionen treten zu lassen.
Entstanden ist eine Publikation, die trotz ihres staubtrockenen Titels zum Bewegendsten gehört, was man in den letzten Jahren über und zu Schumann lesen konnte. Erstmals bekommt eine vermeintlich im permanenten Dunkel geistiger Umnachtung liegende Zeit ein Gesicht, eine Geschichte. Deutlich wird: Das abdriftende Ich des Künstlers erreicht vor allem im ersten Jahr immer wieder Inseln der Gesundung. Mit Hoffen und Bangen nimmt man zur Kenntnis, wie Schumann zu musikalischer Betätigung findet, am Klavier improvisiert, mit Brahms vierhändig spielt, am Musikleben teilnimmt, mit Verlegern korrespondiert und wie er komponiert. Letzteres allerdings relativieren, bagatellisieren die Irrenärzte zum bloßen „Notenschreiben“. „Schumanns Seelenadel“ gilt ihnen, so die psychiatriekritische Besucherin Bettina von Arnim, als „Zeichen seiner Krankheit“.
Andererseits – auch die Kollegen vom Fach, auch Clara, auch Brahms und Joachim betrachten Schumanns Endenicher Kompositionen mit Skepsis. Die allgemeine Tabuisierung, ja Dämonisierung der geistig-seelischen Erkrankung im 19. Jahrhundert tut ihre Wirkung. Eine Welt, die peinlich zwischen „gesund“ und „krank“, zwischen „Wahn“ und „Wirklichkeit“ unterscheidet, sieht sich verstört. „Schumann in Endenich“ wird zur Projektionsfläche für die Angst, selbst vom depressiven Sog erfasst zu werden und unterzugehen.
Ernsthaft wollte denn auch kaum jemand zur Kenntnis nehmen, dass Schumann lange Zeit voller Hoffnung und Selbstbehauptungswillen ist. „4. Februar 1855 – Gestern und heute gut gestimmt. Bei der Morgenvisite ungehalten, es gehe schlecht, wolle fort, sey Künstler, sey an ein ganz anderes Leben gewöhnt.“
Erst ab Mitte 1855 wird Schumanns Aufenthalt, freilich auch als Folge der Hospitalisierung, quälend. Bald ist der Verfall nicht mehr aufzuhalten. Schumanns Tod am 29. Juli 1856 „um 4 Uhr nachmittags“ bringt nur für ihn die Erlösung. Der Blick der Zurückgebliebenen bleibt unfrei. Einer Reihe von Kompositionen, die in Endenich oder im Umfeld von Endenich entstehen, erteilt Clara Schumann Publikationsverbot. Manches andere wie Schumanns „Cello-Romanzen“ oder seine Fugenkompositionen verschwinden sogar auf Nimmerwiedersehen.
Es gehört zu den Vorzügen dieser Publikation, dass all dies vorbehaltlos auf den Tisch gelegt wird. Herausgeber Bernhard Appel hält sich strikt ans Dokumentationsprinzip: Alles offenlegen, nichts bewerten. Dass am Ende, wenn der Vorhang zugezogen wird, manche heiß diskutierte Frage ungeklärt bleibt (etwa die nach der exakten Diagnose von Schumanns Erkrankung), mag man verschmerzen. Schizophrenie? Paralyse? Was liegt daran!? – Denn was diese Dokumentation zu einem Glücksfall der Schumann-Forschung macht, ist gerade das Vermeiden von Thesenbildungen. Angesichts des Banns, der über Schumann verhängt wurde, erscheint die Mischung aus Faktenfülle und Urteilsabstinenz als ungemein glückliche Strategie. Man spürt: „Schumann in Endenich“ bleibt so lange ein unabgeschlossener, unausgestandener Fall, bis unser Blick auf ihn aufhört, angstbesetzt, pathologisierend zu sein.
Natürlich lässt sich einer strikt biographiehistorisch ausgerichteten Dokumentation schlecht vorwerfen, keine musikalischen Fragen zu verhandeln. Andererseits nährt ein Monument wie das hier vorgelegte die Hoffnung, dass damit der schlechten Spekulation um „Schumann in Endenich“ das Wasser abgegraben ist. Dann nämlich könnte (endlich möchte man sagen) die Energie aufs Musikalische gehen – aufs ganze Werk, versteht sich.
Georg Beck