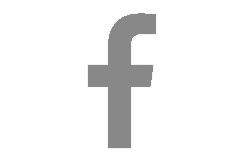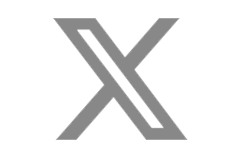Burger-Güntert: Robert Schumanns ›Szenen aus Goethes Faust‹.
Die Tonkunst
Magazin für klassische Musik und Musikwissenschaft
Januar 2008, Nr. 1, Jg. 2, Seite 115-120
Burger-Güntert: Robert Schumanns ›Szenen aus Goethes Faust‹.
Dichtung und Musik, Freiburg i. Br. [u.a.]
(Rombach Verlag) 2006
Erst seit den 1970er Jahren kehrten Robert Schumanns »Szenen aus Goethes Faust« in Deutschland nachhaltiger ins Musikleben zurück, nachdem sie jahrzehntelang in der Schumann-Literatur und in oratoriengeschichtlichen Abhandlungen ein teil gerühmtes, teils gerügtes Dasein gefristet hatten. Der 1971 vom Rundfunk übertragenen Münchner Aufführung unter Leitung Erich Leinsdorfs (mit deutlichen Instrumentationsretuschen) folgten ab 1972 kommerzielle Einspielungen, die unter anderem von Benjamin Britten, Pierre Boulez, Bernhard Klee, Claudio Abbado und Philippe Herreweghe geleitet wurden; im Schumann-Jahr 2006 führte auch Nikolaus Harnoncourt das von ihm hochgeschätzte Werk auf (mit Rundfunkübertragung). Erwähnt sei noch die Ende 1944 im zerbombten Berlin produzierte, kurios gekürzte, doch durch schlankes Musizieren für sich einnehmende Rundfunkaufnahme unter Leitung Hans Schmidt-Isserstedts.
Schumann-Biographik und Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts hinkten diesen künstlerischen Aktivitäten zumeist hinterher, sieht man von Ausnahmen ab wie Donald Mintz’ Beitrag »Schumann as an Interpreter of Goethe’s Faust« (1961) und Friedhelm Krummachers (für die hier zu besprechende Arbeit wegweisendem) Aufsatz »›an Goethe vorbei?‹ – Gedanken zu Schumanns Faust-Szenen« (1985). 1996 näherte sich dann Kathrin Leven-Keesen in ihrer Göttinger Dissertation »Szenen aus Goethes Faust (WoO3). Studien zu Frühfassungen anhand des Autographs Wiede 11/3« dem Werk primär aus philologisch-entstehungsgeschichtlichem Blickwinkel. Doch eine umfassende analytische Untersuchung der textlichen und kompositorischen Konzeption stand weiterhin aus, wie Edda Burger-Güntert zu Beginn ihrer 2005 angenommenen Freiburger Dissertation erstaunt konstatiert. Dabei kann die zwischen 1844 und 1853 entstandene, in Ouvertüre und sieben Großteile gegliederte Komposition zu Schumanns Hauptwerken gezählt werden, wie die Autorin immer wieder (mit Recht) betont. Bei einer solchen Untersuchung müsste Schumanns kompositorische Reaktion auf Goethes – mit dem Begriff »Schauspiel« nur unzureichend zu erfassende – Dichtung musik- und literaturwissenschaftlich analysiert und zugleich mit Schumanns Goethe-Verständnis auch die »Faust«-Rezeption des 19. Jahrhundert aufgearbeitet werden.
Die fast 700-seitige, engagiert argumentierende, interdisziplinär konzipierte literaturwissenschaftliche Dissertation kann die in der Einleitung beklagte Forschungslücke erheblich verkleinern. Indem sie literaturhistorische Hintergründe und Prämissen klärt, sich mit der Goethe- und »Faust«-Rezeption des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt, Schumanns Goethe- und »Faust«-Verständnis untersucht und die bisherige wissenschaftliche Diskussion von Goethes Dichtung und Schumanns Vertonung kritisch in den Blick nimmt, führt sie zu beträchtlichem Erkenntnisgewinn. Daran ändern weder bestimmte Probleme des interdisziplinären Ansatzes noch eine gewisse Redundanz bei der Darstellung ihrer Kerngedanken etwas.
Überzeugend verdeutlich Burger-Güntert, wie avanciert und alles andere als klischeehaft-klassizistisch Schumanns Goethe-Rezeption zu seiner Zeit war: »Die rezeptionsgeschichtliche Bedeutung des engagierten Einsatzes Schumanns für den umstrittenen Zweiten Teil [von Goethes »Faust«] kann nicht genug hervorgehoben werden: Er war der erste Komponist, der bedeutende Partien eines aufgrund seiner Komplexität und seines hohen literarischen Anspruchs als nur schwer verständlich und als ›incomponibile‹ geltenden Werkes vertonte und der Öffentlichkeit zuführte.« (164) Schumanns kompositorische Goethe-Rezeption habe sich nicht allein auf »Faust II« beschränkt, sondern gleichermaßen auf andere späte Dichtungen, vor allem »Wilhelm Meisters Lehrjahre«, denen Schumann ja die Gedichttexte der Lieder und Gesänge op. 98a für Gesang und Klavier und des zugehörigen »Requiems für Mignon« op. 98b für Chor, Solostimmen und Orchester entnahm. Bemerkenswert sei auch seine intensive Würdigung des Goethe-Zelter-Briefwechsels gewesen. So erweise sich Schumann als »ungewöhnlicher und vorausblickender Goethe-Leser, der quer zum ›mainstream‹ der Goethe-Rezeption seiner Zeit steht – und dem sich wohl gerade deshalb zentrale Züge des Werkes, besonders der Altersdichtung entdeckten« (102). Mit dem Dichter verbinde den Komponisten aber auch die Grundhaltung der »Melancholie« (47ff.). Nicht weniger aufschlussreich sind die kurz angesprochenen Beziehungen zwischen Schumanns Goethe- und Bach-Rezeption (70). Und ähnlich wie im Falle Goethes habe er für das Spätwerk Beethovens, das damals eine enorme »Herausforderung« für die Mit- und Nachwelt darstellte, eine geradezu avantgardistische Aufgeschlossenheit gezeigt (82ff.). Von Schumanns intensiver Nutzung und Verbreitung (auch) der späten Dichtungen Goethes zeugt nicht zuletzt seine umfangreiche, 1998 von Leander Hotaki herausgegebene und kommentierte Mottosammlung, aus der er in Briefen und in der »Neuen Zeitschrift für Musik« zitierte.
Eingehend behandelt die Autorin mit Blick auf Goethes dichterisches Schaffen den Paradigmenwechsel in der ästhetischen Bewertung des »Fragments«, die ja Goethes »Faust«-Dichtung ebenso betrifft wie die – zwangsläufig auf eine Textauswahl begrenzten, fragmenthaft intendierten und konzipierten – »Faust-Szenen«. Dabei wird auch das Spannungsverhältnis zwischen Aphoristischem – etwa im »West-östlichen Divan«, den Schumann eingehend rezipierte – und dem durch die Aphorismen hindurch imaginierten ästhetischen ›Ganzen‹ plausibel erörtert. Dass Schumanns Textauswahl für die »Faust-Szenen« gezielt exemplarisch erfolgte – wobei der literarisch gebildete, »supplierende« (Goethe), das heißt ausgesparte Inhalte eigenständig ergänzende, das Werk als Ganzes mitreflektierende Hörer der ideale Rezipient war –, macht Burger-Güntert wiederholt deutlich (77ff., 92ff., 141ff.). Dadurch widerspricht sie scharf der selbst in der jüngsten Schumann-Literatur (»Schumann-Handbuch«, Stuttgart/Kassel 2006, 508f.) noch ernsthaft in Betracht gezogenen Behauptung, die Szenenauswahl folge keinem stringenten inhaltlichen Konzept (siehe etwa 155). Auch sonst überzeugt Burger-Günterts kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen »Faust«-Rezeption der Goethe- und Schumann-Literatur, wobei gelegentlich hübsche Ohrfeigen verteilt werden (404: »Die tiefdringende Erkenntnis Fausts […] wirft ein ganz anderes Licht auf den ›größenwahnsinnigen‹ Monolog und übersteigt den eingeschränkten Blickwinkel des Nihilisten Mephisto – und auch einiger Faust-Untersuchungen – auf das hier neu entfachte Streben Fausts, gründet doch in ihr als einem Ausdruck der tätigen Lebensbejahung seine eigene Befreiung aus den Fängen des Teufels.«)
Indem Burger-Güntert die »Faust-Szenen« – die man allerdings nicht umstandslos zu den »Spätwerken Schumanns rechnen sollte, wie Seite 34 zu suggerieren scheint – nachhaltig vom Vorwurf beliebiger Textkompilation entlastet, macht sie zugleich die »Kongenialität« (15,39) von Schumanns »Faust«-Vertonung zur Prämisse und zum Resultat ihrer Untersuchung und bewertet dabei die »Faust-Szenen« als »Idealfall« der Verbindung von Dichtung und Musik.
Widmet sich die Arbeit nach einführenden Bemerkungen zum Untersuchungsgegenstand und zur Forschungslage eingehend der Goethe-Rezeption Schumanns sowie der »Faust«-Rezeption des 19. Jahrhunderts, so geht es im mehr als 500-seitigen V. Teil konkret um Schumanns »Faust-Szenen«. In den übergreifenden Überlegungen »Zur Struktur der Szenen aus Goethes Faust« (V.!) wird unter anderem der Weg »Vom Opern-Plan zur szenischen Gestaltung« beleuchtet. Von Schumanns Biographen Wilhelm Joseph von Wasielewski ist die Aussage des Komponisten überliefert, eine Gesamtaufführung der »Faust-Szenen« möchte »höchstens mal als Kuriosität […] geschehen dürfen« (Robert Schumann. Eine Biographie, Leipzig 41906, S. 434). Dies steht natürlich in gewissem Widerspruch zu genau dem Werkcharakter, den Burger-Güntert den »Faust-Szenen« a priori zuspricht. Während sie dieses Problem zumindest ansatzweise erörtert (192-196), klammert sie Wasielewskis fast noch brisantere Mitteilung aus, Schumann habe laut eigener Aussage beim Komponieren »hauptsächlich daran gedacht«, dass die (also einzelne oder ein Teil der) »Faust-Szenen« »vielleicht zur Komplettierung von Konzertprogrammen dienen könnten, da man derartige Kompositionen für Solo- und Chorgesang in kleinerem Umfang fast gar nicht« habe (Wasielewskis, a. a. O.). Stattdessen weist Burger-Güntert schon in ihren strukturellen Grundsatzüberlegungen auf das beziehungsreiche textliche Inhalts- und Verweisnetz hin, das Schumann durch die Szenenwahl und durch die hierauf reagierenden motivischen Verknüpfungen schuf.
Auf den mehr als 470 Seiten des eigentlichen Hauptteils V.2 (»Schumanns Szenen aus Goethes Faust – Verstehen von Kunst durch Kunst. Schumanns Faust-Vertonung«) folgen eingehende analytische Untersuchungen, die die werkgenetisch orientierte Dissertation Leven-Keesens verschiedentlich mit Gewinn nutzen (vgl. etwa 239, 245, 424, 432, 441). Veranschaulicht werden die Analysen durch zahlreiche, überwiegend dem Klavierauszug entnommene Notenbeispiele, bei denen spezifische Details bei Bedarf sinnvoll durch Grau-Hinterlegung hervorgehoben werden. (Die Notenbeispiele 2 und 6 auf 200 und 203 sind freilich redundant, da identisch.)
Substanziell haben die musikalischen gegenüber den literarischen Analysen nur eine begrenzte Reichweite. Den Anspruch, in ihrer Arbeit die »Kongenialität« von Schumanns »Faust«-Vertonung wissenschaftlich zu erfassen, möchte die Autorin vor allem dadurch einlösen, dass sie zu zeigen sucht, wie ›kongenial‹ Schumann durch Textzusammenstellung, bestimmte motivisch-thematische Beziehungen zwischen den Szenen (einschließlich der Ouvertüre) und in kompositorischen Gestaltungsdetails auf Goethes Text reagierte. Äußeres Symptom für das Primat der Dichtung in ihrem Untersuchungsansatz ist schon, dass sie meist nicht mit Schumanns, sondern mit Goethes Szenen-Bezeichnungen operiert (so nennt sie die zuerst komponierte große Schlussszene in der Regel nicht »Fausts Verklärung«, sondern nur »Bergschluchten«). In den analytischen Ausführungen, bei denen harmonischen Sachverhalten ein besonderes Augenmerk gilt, gibt es zahlreiche überzeugende Einzelbeobachtungen (wie etwa diejenigen auf 427 und 434 zu »Fausts Tod«). Die Analysten weisen sicherlich nicht mehr ›handwerkliche‹ Irrtümer auf als viele primär musikwissenschaftliche Dissertationen (wenn auch z. B. die Seiten 219-221, 424f. oder 430f. hinsichtlich harmonischer Sachverhalte und Prozesse recht fehleranfällig sind, charakteristische Sequenzmodelle nicht immer hinreichen erfasst werden und bei den Ausführungen auf 223 Bass- und Violinschlüssel sowie auf 440 und 444 Trompeten und Hörner verwechselt werden). Stets aber dominiert die worttextbezogene, ausgesprochen deskriptive Nacherzählung kompositorischer Verläufe. So weit und differenziert Burger-Günterts Blick auf Goethes Dichtung erscheint, so sehr wird die Musik vielfach auf ihre textausdeutende Funktion – früher hätte man gesagt: auf ihre Rolle als ›Dienerin‹ des Textes – reduziert. (Dabei soll keineswegs einer wortunabhängigen Analyse das Wort geredet, sondern nur die eingeschränkte musikalische Analyseperspektive charakterisiert werden.) Dem engen Verständnis der »Kongenialität« entspricht das begrenzte analytische Instrumentarium. Die Beobachtungen konzentrieren sich auf harmonische, instrumentatorische Details und vor allem auf »aszendente« und »deszendente« Bewegungen der melodischen Linien und Begleitmotive. Zu selten gilt das analytische Interesse den über reine Textbezüge hinaus wirksamen (autarken oder jedenfalls meta-literarischen) musikalischen Strukturen und Prozessen, die für die »Faust-Szenen« so bezeichnend sind. Symptomatisch für die Analysesprache der Arbeit sind Passagen wie die folgenden: »Mit einem sanften aszendenten Melisma erhebt sich die Singstimme zum Phrasenhochton f“, um in der Pause die überleitende aszendente Dreiklangsbrechung in den Celli [recte: Bratschen!] (T. 16) durchklingen zu lassen.« (239) »Im pausendurchsetzten Satz der übrigen Streicher, deren piano-pizzicato-Achtel im marcato spitz hervorstechen, scheint sich das klappernde ›Flickwerk‹ der ›schlotternden Lemuren‹ zu spiegeln.« (417) Anders als die aufschlussreichen Erörterungen der »Faust«-Dichtung lesen sich derart deskriptive Durchgänge durch den Notentext auf die Dauer mühsam. Zu wenig wird man bei der Lektüre animiert, über den Tellerrand des Textvertonungs-Details hinauszublicken und das Ganze der »Faust-Szenen« sowie ihre Stellung in Schumanns Œuvre in Blick zu nehmen, wie einige exemplarische Bemerkungen zeigen sollen:
1. Die starke motivische Kohärenz der 6. Szene (»Fausts Tod«) wird von der Autorin allein aus der Perspektive der Textdeutung interpretiert. Die Motivik interessiert sie also nur als Äquivalent zum Ausschaufeln von Fausts Grab durch die Lemuren, was von Faust als Graben der Arbeiter bei seinem Landgewinnungs-Projekt missdeutet wird (vgl. vor allem 420ff.). In den Hintergrund gerät, wie faszinierend Schumann hier kompositorische Zusammenhänge stiftet und Prozesse gestaltet, die selbst Kontrastierendes wie die Ebenen von Mephisto/Lemuren und Faust überbrücken und bündeln. Zwar werden die grundlegende Staccato-Motivik ab T. 51 und die Transformationen der Signalmotivik ab T. 83 in ihrem textinterpretatorischen Potential beschrieben, doch der weit hierüber – und auch über bloße ›obligate Motivik‹ - hinausführende musikalische Prozess bleibt nahezu ausgeklammert. Die abschließende Marcia funebre in C-Dur ist für die Autorin lediglich ein »Orchesternachspiel« (444; vgl. 202), das zugleich zur großen Schluss-Szene »Fausts Verklärung« überleitet (siehe 444, 447). Dass »Fausts Tod« in diesem integralen Instrumentalteil lyrisch kulminiert und damit letztlich eine fast symphonische Dichte erreicht (ähnlich wie später in Brahms’ »Schicksalslied«, dessen rein orchestraler Schlussteil ohne Schumanns Beispiel kaum denkbar erscheint), dass hier zudem rein musikspezifisch die Einflüsterungen und Einflüsse Mephistos letztgültig eliminiert werden, gerät nicht in den Blick der Autorin. Dagegen geht aus ihren Ausführungen dankenswert deutlich hervor, dass Schumanns Interpretation primär aus der Perspektive Fausts erfolgt und diese idealistische Sicht eine durchaus ›historische‹ ist.
2. Burger-Güntert äußert sich schlüssig zur Auswahl und Textdisposition der ersten drei Szenen, die Gretchen in den Mittelpunkt stellen, und spricht viele Einzelheiten der kompositorischen Gestaltung an (wenn auch nicht ohne Irrtümer: Gretchen »verstummt« in der eröffnenden »Szene im Garten« keineswegs nach dem »Mich überläuft’s« von T. 49, wie auf 221 behauptet wird, sondern übernimmt in T. 65/66 sogar den vokalen Beschluss, der einen der melodischen Höhepunkte und zugleich ihre direkteste Gefühlsäußerung bildet; 236: a-Moll fungiert nicht als Paralleltonart zu F-Dur, sondern als Mediante). Mit Recht weist sie auf die subtile rhythmische Verbindung der Szenen 1 und 2 hin, die deren tragischen Kontrast unterstreicht (235). Dass und wie die Szenen 1-3 tempomäßig nahezu eine Einheit bilden, aus der letztlich eine Art Bewegungssteigerung erwächst (Nr. 1: punktierte Viertel = 60; Nr. 2: Viertel = 56 mit vorübergehend anziehenden Tempi; Nr. 3: Viertel = 66 mit mehreren Temposteigerungen), spielt in ihren Überlegungen zur Musik jedoch ebenso wenig eine Rolle wie die Tatsache, dass Ouvertüre und Szenen 1-3 tonartlich geschlossen konzipiert sind (d-Moll – F-Dur, a-Moll – d-Moll).
3. Nicht zuletzt wegen ihres worttext-fixierten Ansatzes fehlt der Arbeit eine überzeugende grundsätzliche Argumentations- und Urteilsbasis – um nicht zu sagen Theorie – im Hinblick auf das Verhältnis von Text und Musik. War es, wie Peter Horst Neumann 2002 monierte, ein künstlerisches Versäumnis, dass Schumann 1849 bei der Komposition von Szene 2 die Anfangsworte »Ach neige, / Du Schmerzenreiche, / Dein Antlitz gnädig meiner Not!« melodisch nicht als Zitat der 1844 in »Fausts Verklärung« vertonten Textpassage von »Una Poenitentium (sonst Gretchen genannt)« anlegte, die Goethe ja ausdrücklich als Kontrastzitat gestaltet hatte (»Neige, neige, / Du Ohnegleiche, / Du Strahlenreiche / Dein Antlitz gnädig meinem Glück.«). Burger-Günterts berechtigte Kritik solcher Kritik beschränkt sich einerseits auf den Hinweis, dass Schumanns Wahl der Zwinger-Szene den (textlichen) Verweis auf »Fausts Verklärung« bereits impliziere; vorsichtig fügt sie andererseits hinzu: »Vielleicht wollte Schumann […] die Verbindung, die Goethe bereits durch den Verweis schafft, nicht durch eine analoge Vertonung platt verdoppeln, wie er sich überhaupt in den »Szenen« musikalischen [sic!] Verdopplungen der dichterischen Aussage enthält.« (182) Was ihren Überlegungen völlig abgeht, ist eine grundlegende Diskussion der durchaus heiklen Frage nach Entsprechung und Nicht-Entsprechung bei der Vertonung von Textzitaten. Eine solche Diskussion müsste zum einen berücksichtigen, dass Goethe selbst in der Bitte von »Una Poenitentium« zwar Schlüsselwörter und Wortverbindungen zitierte, doch Anfangsmetrik, Zeilenzahl und Wortfügungen änderte, was nicht zuletzt dem kontrastierenden Kontext geschuldet war. Zum anderen verzichtete Schumann zwar auf ein melodisches Zitat, doch haben beide Passagen immerhin die gleiche tonale Basis (a-Moll – A-Dur), verwandte Taktarten (4/4 – 2/2) und ähnliche Instrumentation. Schumann nahm sich die kompositorische Freiheit, die im Worttext explizit ausgetragene Verweispolarität musikalisch ausschließlich subkutan zu akzentuieren. Darüber hätte sich zweifellos exemplarisch diskutieren lassen.
4. Ähnlich begrenzt bleibt Burger-Günterts Blick auf den Formbildungsprozess im Schlussteil der 4. Szene (»Ariel. Sonnenaufgang«). Dass die Zeilen »So bleibe denn die Sonne mir im Rücken!« abschließend wiederholt und durch ein thematisch hieraus abgeleitetes Orchesternachspiel unterstrichen werden, kann Burger-Güntert zwar aus der Perspektive der Dichtung interpretieren (346f.). Doch im Hinblick auf die Musik wäre zugleich darauf zu verweisen, dass Schumann erst durch diesen Rückgriff eine musikalische bogen- bzw. Reprisenform schuf, die das strukturelle Gegengewicht zu der exquisiten tonmalerischen harmonischen Entwicklung schafft, die Schumann der Zeile »am farb’gen Abglanz haben wir das Leben« zuordnete. So integrierte der Komponist in die 449-taktige episodische Großform dieser Szene abschließend eine Art Miniatur-Arie als formstabilisierendes Element.
5. Wiederholt verweist Burger-Güntert auf die herausragende Stellung der »Faust-Szenen« in Schumanns Œuvre und in der kompositorischen »Faust«-Rezeption des 19. Jahrhunderts. Sie untermauert diese Einschätzung letztlich aber nur begrenzt (wobei keine »Beweise«, sondern Argumente und Interpretationsaspekte gefragt wären). Kaum wagt sie einen näheren kompositionsspezifischen Blick auf die übrigen vokal-orchestralen Werke Schumanns. Lediglich die Erlösungsthematik, die »Das Paradies und die Peri«, »Der Rose Pilgerfahrt«, die »Faust-Szenen« und – inhaltlich durchaus zwiespältig – die »Manfred«-Schauspielmusik verbindet, wird angesprochen (164-166). Wenn die Autorin dabei die schon erwähnte Marcia funebre am Ende von »Fausts Tod« mehrfach als »Requiem«, »Requiem für Faust« oder »Tombeau« bezeichnet (siehe etwa 49, 165, 444), dann erscheint diese Gleichsetzung terminologisch und inhaltlich problematisch. Ähnlich problematisch ist im Übrigen die Rubrizierung des »Requiems für Mignon« op. 98b unter die »Idee der Erlösung« (47, vor allem 49f.), was Goethes Text kaum gerecht wird, bewegt dieser sich doch zwischen den Polen der Totenklage und der wiederum welt-zugewandten Tröstung der Trauernden. Wer die »Faust-Szenen« innerhalb von Schumanns Œuvre und in der Geschichte der kompositorischen »Faust«-Rezeption angemessen würdigen will, sollte zumindest ansatzweise nach dem Spezifischen dieses Werkes fragen. Ein Ansatzpunkt könnte sein, dass Goethe »sublime Poesie«, von der Schumann mit Blick auf die Schlussszene sprach (siehe 164 mit Anm. 82), dem Komponisten das Problem der konventionellen Folge geschlossener ›Nummern‹ und ebenso die Verwendung des von ihm in »Peri«, »Genoveva« und »Rose« entwickelten ariosen Rezitativs weithin ersparte. Zwar gibt es in den »Faust-Szenen« rezitativische Passagen und kürzere arienähnliche Abschnitte, doch sind diese fest in größere Zusammenhänge integriert. Anlage und literarische Qualität der »Faust«-Dichtung verhinderten von vornherein jeglichen konventionellen Opernton oder quadratische Periodenbildungen. Goethes Text animierte Schumann vielmehr zu einer höchst variablen, vielschichtig-originellen, künstlerisch selbstbewussten Verknüpfung und Kontrastierung der Abschnitte, bei der die Musik stets im Fluss bleibt. Auf Hinweise dieser oder anderer Art wartet man in Burger-Günterts Arbeit vergebens.
Während also die Untersuchung im Hinblick auf Schumanns Auseinandersetzung mit Goethes literarischer Produktion, dem Spätwerk und insbesondere der »Faust«-Dichtung erfreulich ertragreich ist, bleibt die Auseinandersetzung mit der Musik der »Faust-Szenen« gleichsam halbseitig blockiert. Auf welche Weise und in welchem Maße die von der Dichtung inspirierte und hierauf reagierende Komposition mit ihren spezifischen Gestaltungsmitteln wiederum die Dichtung prägt und transzendiert, dadurch als Kunstwerk einen neuen Rezeptionsgegenstand und eine neue Rezeptionsperspektive schafft, bleibt vielfach ungefragt und unbeantwortet. Das zeigt sich auch in der kurzen Schlußbetrachtung (671-674). Dort unterstreicht die Autorin, ihre Arbeit habe »erstmals mittels einer detaillierten, von der Dichtung als Basis der Vertonung ausgehenden Untersuchung […] ein besseres Verstehen der Szenen aus Goethes Faust« angestrebt, so dass es »nun [!] keinen ›Punkt‹ mehr in der Partitur« zu geben scheine, »der nicht von dieser einzigartigen Begegnung von Dichtung und Musik durchdrungen« sei (was für Schumanns Werk genau genommen natürlich schon vor dem Erscheinen der Arbeit galt). Zweifellos kam in den »Faust-Szenen« zu »einem Dialog der Künste, wie er inniger und faszinierender, aber auch anspruchsvoller und fordernder kaum sein kann.« (671 Die Rolle der Musik bleibt bei Burger-Günterts Analyse dieses Dialogs freilich (zu) stark auf die Perspektive der direkten Wort- und Sinnausdeutung des Goethe’schen Textes begrenzt. Dennoch sind die Verdienste dieser erfreulich unverquast, in einzelnen Formulierungen allerdings etwas leichthin formulierten Arbeit unbestreitbar (und werden durch die hier vorgebrachten musikspezifischen Einwände womöglich sogar zu sehr verschattet). Sie ist aus der weiteren Auseinandersetzung der Goethe- und Schumann-Forschung mit Schumanns Meisterwerk nicht mehr wegzudenken, lässt aber gerade im Hinblick auf die Musik Raum für neue Untersuchungen.
(Michael Struck)