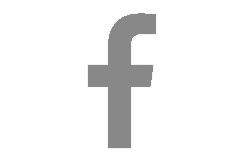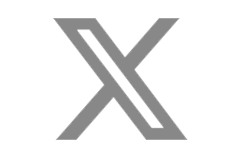Interview mit Annette Dasch,
in: Opernwelt 3/2007, S. 35 ff.
Der lange Weg zum Selbst
Annette Dasch ist eine gefeierte Mozart-Sängerin. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie 2002 als Fiordiligi in der Antwerpener «Cosi» unter Jos van Immerseel. 2004 folge ein «Figaro» in Paris unter René Jacobs, ein Jahr später «Lucio Silla» unter Nikolaus Harnoncourt in Wien, 2006 «Il Re pastore» unter Thomas Hengelbrock in Salzburg und zuletzt die Donna Elvira an der Mailänder Scala. Im Juni 2008 wird Annette Dasch zur Wiedereröffnung des generalsanierten Münchner Cuvilliés-Theaters unter Kent Nagano die Elettra in «Idomeneo» singen. Zuvor wagt sich die Sopranistin jedoch – nach der Gänsemagd in der Münchner Produktion von Humperdincks «Königskindern» - an ihre erste Wagner-Rolle: Freia im «Rheingold» unter Simon Rattle bei den Salzburger Osterfestspielen. Diesen Sommer verkörpert sie zur Eröffnung der Sommerfestspiele an der Salzach unter Ivor Bolton die Titelrolle in Haydns «Armida» (Regie: Christof Loy).
Von Klaus Kalchschmid
Frau Dasch, welche Bedeutung hatten die Eltern für Ihre Liebe zur Musik?
Für meine Eltern war Musik zentral. Sie hatten sich übers Singen kennengelernt, spielten Instrumente und lebten uns vor, dass gemeinsames Musizieren, egal auf welchem Niveau, Spaß macht. Von Familienfesten bis zu Weihnachtsgottesdiensten – es wurde keine Gelegenheit ausgelassen, ein Programm zusammenzuschustern, bei dem alle irgendwie mittönen konnten. Nicht zu vergessen die legendären Autofahrten mit dem Familienbus von und nach Berlin, Transitstrecke sage ich da nur. Der Warterei am Übergang Dreilinden verdanken wir unser Kanon-Repertoire.
Sie haben einmal gesagt, Sie hätten mehrere Stimmbrüche durchlebt?
Sagen wir vielleicht besser Stimmwechsel. Im Schulchor habe ich ausprobiert, wie das mit dem Vibrato funktioniert, wie eine Musical-Stimme klingt, wie man die Königin der Nacht singen könnte. Aber was war Spiel, war Spaß, obwohl ich immer im Chor die Soli sang. Die Klarinette, das war mein Instrument, dafür habe ich richtig geübt. Ich träume manchmal schlecht, weil ich bis heute das Gefühl habe, mein eigentliches Instrument verraten zu haben. Ich spielte sehr viel Kammermusik und Schülerorchester, aber nach und nach machte mir das Singen immer mehr Lust, auch weil es mir scheinbar leichter fiel. Meine Naturstimme war damals sehr dunkel und verhältnismäßig laut – was in der Alte-Musik-orientierten Chorszene nicht gut ankam. Als ich irgendwann mit fünfzehn aufschnappte, dass jemand mich Walküre nannte, fand ich das doppelt bitter, denn ich hatte sowieso ein Problem, meinen «riesigen» Körper zu akzeptieren. Nun war ich also nicht nur größer und breiter, sondern auch noch lauter als alle anderen. Und da es mir leicht fiel, alle möglichen Stile zu imitieren, fing ich an, ganz gerade, hell und knabenhaft zu singen. Fortan strebte ich an zu klingen wie Emma Kirkby. Dieser Engelsgesang zur Laute schien mir das einzig Wahre. Auch wenn ich in die Oper ging, habe ich dieses Klangideal gesucht und mich gefragt, warum die nicht mal ein paar gerade Töne singen können.
Das war also der erste Stimmbruch, wann kam der nächste?
Das war um das Abitur herum, da sang ich schon eine Brautjungfer an der Deutschen Oper und manche Soli in Berliner Kirchen. Auf die große herbstliche Musikreise unserer Schule brachte Andreas Schüller, der mit unserem Schulorchester die ersten Dirigierversuche machte und mittlerweile an der Wiener Volksoper Dirigent ist, für mich Noten mit. Strauss-Lieder, Agathe, Isolde – verrücktes Zeug. Das haben wir dann abends am Klavier vom Blatt gesungen. So intensiv hatte noch nie jemand mit mir Musik gemacht, und auf einmal ging etwas auf in meinem Herzen und in meiner Kehle. Irgendwie hat er meine emotionale Barriere gespürt und gemerkt, dass da etwas nicht deckungsgleich ist. Dass diese Annette und diese Stimme nicht zusammenpassen. Um mir weiter auf die Sprünge zu helfen, ging er mit mir kurze Zeit später in eine «Götterdämmerung» mit Deborah Polaski. Das war der zweite Moment der Offenbarung. Ich erlebte diese große, schöne Frau wie ein Naturereignis. Mir flossen die Tränen, weil ich etwas begriffen hatte. Da war die Bereitschaft geboren, mir dies alles zu erarbeiten, Gesang zu studieren. In jahrelanger Arbeit musste ich dann diese Enge im Hals und den falsch verstandenen Vordersitz loswerden.
Und Sie fanden den richtigen Lehrer, um «Ihre» Stimme zu entdecken…
Ja, mit Josef Loibl an der Münchner Musikhochschule fand ich jemanden, der zu Recht sagte: Sie singen viel zu klein und soubrettig für das, was in Ihrer Stimme drinsteckt. Wenn Sie so aussehen, können Sie nicht so singen. Dafür bin ich ihm ewig dankbar. Denn ich hätte mit 21 sicherlich ein Super-Ännchen gesungen, aber keiner hätte mich dafür engagiert. Also galt es, einige Kilo abzunehmen und gleichzeitig an Stimmvolumen zuzulegen. Natürlich haben wir mit der Susanna angefangen, aber es war klar, da muss bald die Gräfin kommen. Bis heute – bei den «Königskindern» etwa – sagen mir die guten Korrepetitoren bisweilen: Mach nicht diesen engen Tonansatz ohne Vibrato, sing die großen Legatobögen frei aus! Ich merke das oft gar nicht, aber die Furcht vor dem «Zuviel» steckt anscheinend immer noch in mir.
Im Alter von 23 Jahren haben Sie drei internationale Gesangswettbewerbe gewonnen: Maria Canals in Barcelona, den Robert-Schumann-Liedwettbewerb in Zwickau und später, in Genf, den Concours de Genève.
Der war auch vom Repertoire her am umfangreichsten. Jede Epoche, fast jede Sprache musste abgedeckt sein. Ich hatte das Glück, dass Fabio Luisi im Finale das Orchester dirigierte. Er hat mich daraufhin seiner – und bis heute meiner – Agentur empfohlen und mich gleich mehrfach engagiert.
Wann war Ihr professionelles Debüt?
Mein erstes Konzert mit einem richtigen Profiorchester war zum Jahreswechsel 1999/2000 in der Kasseler Oper: Am 27. Dezember klingelte mein Handy, und Marc Piollet fragte mich, ob ich dort bei Beethovens Neunter einspringen könnte. Wir kannten uns aus Berliner Jugendorchester-Zeiten, aber ich hätte nie gedacht, dass er mir das zutraut. Es war der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Dass Marc und ich jetzt zusammen «Hoffmann» an der Bastille machen, ist dadurch umso kurioser. Das Operndebüt war am 6. November 2001 in Bonn – als Pamina. In Antwerpen sang ich dann unter Jos van Immerseel und Guy Joosten die Fiordiligi – mein erstes Auslandsengagement.
Sie haben einmal gesagt, Sie seien die geborene Operettensängerin…
Oh ja, ich habe sehr viel Spaß an Operettenmusik. Leider durfte ich bisher nur einmal die Rosalinde sein, in einer Stockholmer Produktion unter Manfred Honeck, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Also: Sollte irgendwann einmal Herr Marthaler den «Zigeunerbaron» inszenieren wollen – ich wäre liebend gern seine Saffi.
Wie fühlten Sie sich bei Ihrem Scala-Debüt mit Ihrer ersten Elvira?
Ich erfuhr ja erst am Tag selbst, dass ich die Premiere singe. Als der Vertrag zustande kam, war mir wichtig, gerade nicht die Premiere zu singen; die Doppelbelastung von Rollen- und Scala-Debüt war mir einfach zu groß. Nun war Frau Bacelli krank geworden, und ich sprang ein. Zum Glück liebte ich die Inszenierung, und was Peter Mussbach mit uns für Elvira erarbeitet hatte, war so atemberaubend, dass ich keine Zeit hatte, mir der äußeren Umstände bewusst zu werden.
Neben der Oper singen Sie sehr viel Konzert.
Ich kann sagen, dass die Konzerte mit der Akademie für Alte Musik ohne Ausnahme Höhepunkte für mich sind. Außerdem liebe ich Mendelssohns «Elias». Ich habe viele unvergessliche Konzerterinnerungen, wie zuletzt an die Aufführungen im November 2006 unter Seiji Ozawa in Florenz. Und ich liebe Schumann – vor allem seine Lieder und seine großen Vokalwerke. «Genoveva» habe ich mit Marc Piollet in Wien und Wiesbaden gesungen. Das Werk hat eine ungeheure Kraft und lässt mich seitdem nicht mehr los. Im vergangenen Sommer konnte ich die «Faust-Szenen» mit einer fabelhaften Besetzung unter Nikolaus Harnoncourt singen. Es ist schwer zu beschreiben, was sich mir da aufgetan hat. Daher freue ich mich wahnsinnig, dass Harnoncourt mich eingeladen hat, mit ihm im März 2008 nun auch die Peri zu machen.
Bei Ihren Liederabend-Programmen fällt auf, dass Ihnen auch das entlegenere Repertoire am Herzen liegt.
Das geschieht oft per Zufall. Etwa, wenn man im Internet auf vier Lieder von Sofia Gubaidulina nach Texten von T. S. Eliot stößt. Ich versuche, in die Programme meiner Liederabende neben Standardrepertoire auch immer wieder Unbekannteres einzubauen. Damit meine ich nicht nur selten gehörte Komponisten, sondern auch unbekanntere Lieder von Schumann, Schubert. Besonders freue ich mich auf ein Projekt in dem neuen Berliner Veranstaltungsort Radialsystem. Ich möchte da in Zusammenarbeit mit meiner geliebten Akademie für Alte Musik in einer Reihe deutsche Barocklieder präsentieren. Da gibt es noch unerhört viel Repertoire zu entdecken. Und ich möchte als Besonderheit gern versuchen, das Publikum mitsingen zu lassen.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Sie wurde bei einer CD-Präsentation meiner Solo-Platte geboren, als das Publikum in der Zugabe einen Refrain mitsingen sollte. Und man spürte förmlich, die Enttäuschung der Leute, nicht mehr mitsingen zu dürfen. Warum also nicht mal einen Abend, bei dem man immer wieder mitmachen darf. Denn viele dieser Lieder sind ja gedacht als «Hausmusik». Wenn das funktioniert, würde ich gerne eine Reihe initiieren, bei der es zum Kontrast Lieder aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt. Denn die Sprache ist ja immer eine Brücke – selbst für die komplizierteste Neue Musik.
Was sind Ihre Pläne für die Opernbühne?
Ich bin sehr glücklich, dass ich mit der Freia einen ersten Ausflug ins jugendlich-dramatischere Fach wagen kann, um dann wieder zu Haydn und Mozart zurückzukehren. Ich freue mich sehr auf Armida und Elettra, die ja sehr dramatische Figuren sind, denen man aber mehr mit Gestaltungskraft als mit Stimmschwere begegnen muss. Im Jahr 2009 ist eine Desdemona geplant, die nach meiner Dresdner Liù ein neuer Schritt ins italienische Repertoire sein wird. Sofort würde ich am liebsten Oktavian sein, und bald vielleicht Agathe.