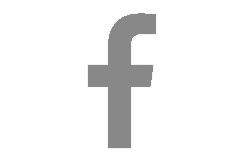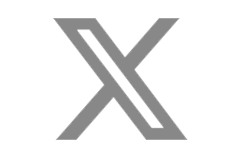Auch Gottesgaben sind versenkbar
[Und "keiner anderen Kritik wird das Beweisen so schwer als der musikalischen", seufzte schon Robert Schumann, der selbst als Musikschriftsteller freilich darin Meister war.]
Dem Rausch des Ruhms und des Geldes können wenige widerstehen: Dabei presst die Musikindustrie ihre Wunderkinder aus, lässt sie so schnell fallen, wie sie sie aufgebaut hat. Auf der Strecke bleibt die Musik als große Zeitkunst.
Hurra, Netrebko singt wieder. Heute abend in der Köln Arena. "Topfit" sei die Anna, teilte Konzertveranstalter Deag Classic gestern mit. Und ihr Agent Van Almsick versichert, dass sich die schöne Sopranistin nach allem, was war, jetzt um so mehr freue auf ihren gemeinsamen Auftritt mit dem "Weltklassetenor" Marcelo Alvarez. Soweit die gute Nachricht. Es ist zugleich eine schlechte. Denn erstens singen die beiden wieder einmal open air, mithin komplett durchmikrophoniert, was den Stimmen schadet und auch die Musik - kleine Häppchen aus großen Opern - nicht unbeschädigt läßt, vor allem aber die Hörfähigkeit ihres Publikums unterfordert und dessen Hörgewohnheiten weiter ruiniert. Zweitens gehört Alvarez nicht zur Weltklasse, er ist Einspringer, zweite Wahl. "Weltklassetenor" Rolando Villazón, der noch bis vor wenigen Monaten Hand in Hand mit Annar Netrebko als das erfolgreichste "Traumliebespaar der Operwelt" von Auftritt zu Auftritt spurtete, sucht zur Zeit verzweifelt seine Stimme.
Sie ging verloren zwischen der ersten und der zweiten Vorstellung von Jules Massenets Oper "Manon" an der Staatsoper in Berlin im Mai dieses Jahres. Seither sind alle Termine Villazóns abgesagt worden, prophylaktisch bis in den Dezember hinein - was bei der Höhe der Gagen insbesondere seiner Preisliga sowie dem langen Terminvorlauf der Klassikbranche im allgemeinen einen noch nicht absehbaren finanziellen Verlust bedeuten wird, weniger für den Sänger selbst, vielmehr für alle Firmen und Agenturen, die an ihm gut verdient haben.
"Ich bin nicht mehr nur ein Sänger, ich bin ein Produkt", hatte Rolando Villazón kurz vor seinem Absturz noch der Zeitschrift "Operglas" anvertraut. Er war sich offenbar selbst im klaren darüber, was mit ihm gerade geschah: Hier ist, und zwar nicht zum ersten Mal, ein hervorragender Musiker skrupellos verheizt worden durch das aggressive Marketing einer von Untergangsvisionen gehetzten, von der Jagd auf die Quote hysterisierten und zu allem Übel auch noch von den visuellen Medien täglich neu gedopten Klassikindustrie. Die Serie der Sängerabsagen in letzter Zeit spricht eine deutliche Sprache: Kozena, Garanca, Netrebko, Shicoff, Kasarova - die derzeit Meistherumgereichten sind dabei. Villazóns Fall scheint besonders ernst. Längst wissen alle vom Fach Bescheid, heucheln Bedauern und rätseln hinter vorgehaltener Hand, ob die Blockade stimmtechnischer Natur sei (beschädigt durch Überanstrengung und übermäßiges Forcieren) oder eher psychisch bedingt, oder, was am wahrscheinlichsten ist, beides.
Das Musikinstrument eines Sängers ist der eigene Körper. Bei keinem anderen Musiker liegen Seele und Tonleiter, Gefühl und Technik so dicht beieinander. Einige verzweifelte Versuche Villazóns, diesen Teufelskreis zu durchbrechen mit Auftritten abseits der Medienöffentlichkeit, sollen, heißt es, kläglich gescheitert sein, zuletzt in Trondheim. Wir können also nur abwarten und hoffen, dass sich dieses Ausnahmetalent mit der schimmernden Höhe, dem enorm weiten Ambitus, der feurigen Attacke und der intelligenten Ausdruckstiefe eines Tages wieder fangen wird. Unterdessen ist Zeit gekommen, anzuklopfen bei den Verantwortlichen.
Keineswegs beschränkt sich ja dieses katastrophische Künstlermanagement nur auf die Sänger. Auch junge Geiger und vor allem - daran sind gewiß die schulterfreien Abendkleider nicht unschuldig, mit denen Anne Sophies Mutter einst den Trend setzte - die hübschen jungen Geigerinnen, auch junge Pianisten, Cellisten, sogar junge Dirigenten werden Saison für Saison neu auf- und wieder abgebaut von der Klassikbranche. Das heißt, sie werden ge- oder vielmehr erfunden, werden als "Weltklasse" etikettiert, auf Tourneen herumgereicht, repertoiremäßig schlecht beraten, überfordert, ausgebeutet und, sollte sich das Management tatsächlich verrechnet haben oder die Rentabilität nicht eintreten, alsbald fallengelassen. Wer tatsächlich eine Hochbegabung in seinem Fach und noch dazu klug und fleißig ist, dem lässt diese dem Marketing der Popmusik abgeguckte neue Klassik-Turbo-Mühle keine Zeit mehr, sich zu entwickeln. Umgekehrt ist es aber auch längst so, dass zur "Weltklasse" erklärt und infolgedessen auch allgemein für "Weltklasse" gehalten wird, wer das künstlerische Können dafür gar nicht mitbringt.
In keinem anderen Metier wird so viel Stroh zu Gold gesponnen, werden so viele Mücken zu Elefanten. In keinem anderen Kunstgenre scheint es aber auch so leicht zu sein, das Geschmacksurteil des Publikums zu lenken und Produkte zu fälschen, wie ausgerechnet in der ehrwürdigen, auf teils jahrhundertealtes Repertoire und bewährte Rituale gestützten klassischen Musik. Und "keiner anderen Kritik wird das Beweisen so schwer als der musikalischen", seufzte schon Robert Schumann, der selbst als Musikschriftsteller freilich darin Meister war.
Musik ist eine Zeitkunst. Man kann das Konzertereignis nicht vor- oder zurückblättern. Noten, die die Musik festzuhalten suchen, verraten selbst den Fachleuten stets nur einen Teil des Phänomens. Die Schallplattenaufnahmen, jederzeit an jeder Stelle beliebig abspielbar, sind zugleich die frechsten Lügenbarone: Sie suggerieren, es bestünde tatsächlich die Möglichkeit, eine perfekte Darbietung ein für allemal eins zu eins abzubilden und für die Nachwelt zu fixieren. Sie sind aber tatsächlich nur ein abstrakter Abglanz des Live-Ereignisses und außerdem von den Zauberkünsten der Tonmeister abhängig, die dem Authentischen des Klangbilds emsig nachhelfen. Keine Live-Aufnahme eines Konzertes geht über den Ladentisch, die nicht mehrfach geschnitten und manipuliert ist. Auch sogenannte Live-Übertragungen werden in der Regel zeitversetzt gesendet, um "Fehler" korrigieren zu können. Ein nicht erreichter Spitzenton, ein verwackelter Einsatz, all das aber letztlich Erbsenzählereien, die über die tatsächliche musikalische Qualität einer Darbietung wenig oder gar nichts aussagen.
Wenn die Musik,, wie Schumann schrieb, eine "Sprache über den Sprachen" ist, wenn sie das Unsagbare sagt; dann ist es allerdings unsinnig und sogar irreführend, "wieder ins Wort zurückzwingen zu wollen, was sich nur (und viel besser) durch Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe auszusprechen vermag" (Schumann). Die musikalische Beweisführung erfolgt also selbst im Zwiegespräch der Fachleute stets nur stammelnd, sie geht an Wortkrücken, muss sich beugen der Macht des subjektiven Gefühls. Gewiss wird die Netrebko heute abend wieder die Herzen rühren und "toll" singen, "wunderbar". Sicher wird es wieder zum "Weinen schön".
Das ist so, wie es ist, und eigentlich weder schlimm, noch neu. Schließlich hat man bereits zu Schumanns Zeiten Klage geführt über die schlampig und schnell erstellte "Fabrikwaare" des Pianistenfutters, über die leichte Verführbarkeit des Publikums, über das Verheizen von Wunderkindern und die puppenhafte Mechanik der Opernsänger, die nur ihre Koloraturen, aber sonst weiter nichts im Kopf haben. Und bereits zu Rossinis Zeiten wurden Witze gerissen über die Tenöre, denen die Halsschlagadern schwellen wie dem Hahn der Kamm beim Versuch, das hohe C länger zu krähen als andere. Einem Tenor in Bologna soll damals sogar eine Ader geplatzt, er soll auf der Bühne verblutet sein, was wir hiermit ins Reich der Legende verweisen. Wahr und verbürgt ist, dass Villazón keineswegs der erste hochbegabte junge Sänger ist, der sein Talent für eine Gottesgabe, mithin für so unversenkbar hielt wie die "Titanic" und deshalb dem Rausch des Ruhms und der Verlockung der Überbeschäftigung nicht widerstehen konnte.
Verbürgt ist aber auch, dass sich im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit der Musik nicht nur der Musikmarkt gründlich verändert hat, sondern auch das Musizieren, das Musikhören. Insofern spiegelt sich in der Krise der Schallplattenbranche, wie Norman Lebrecht sie elegant und boshaft beschreibt in seinem neuesten Buch "Ausgespielt - Aufstieg und Fall der Klassikindustrie" (im Schottverlag), zugleich die gesellschaftliche Krise der klassischen Musik: Nicht nur einzelne Sänger werden krank an Leib und Seele, auch der Umgang mit der klassischen Musik in unserer Gesellschaft hat einen Schlag ins Pathologische.
Lebrecht geht aus von den goldenen Gründerjahren der klassischen Musik-CD zu Karajans Zeit, als der Tonträgermarkt boomte und alle Klassikliebhaber ihre Plattensammlung runderneuerten. Er zeichnet mit flott daherfabulierten Thesen und einer Fülle von sachlich-fachlichen Fehlern, aber zugleich erfrischender Detailkenntnis in Sachen Klatsch und Tratsch den Konzentrationsprozeß dieser Branche nach. Heute leben, nach einem erbarmungslosen Verdrängungswettbewerb, nur noch vier große Klassik-Labels, und bei allen vieren sind die Geschicke des kleinen Klassiksegments dem Management des ungleich größeren Popmusiksegments unterstellt worden. Das führt zu den seltsamsten Blüten. Schnuppen werden zu großen Sternen, Supernovas verglühen, kaum, dass sie aufgetaucht sind. Seltsame Crossover-Produkte werden erfunden von den Popmusikchefs der Klassikabteilungen, Millionen versenkt für Retortenprodukte, die Eintagsfliegen bleiben. Und in jeder Saison muß wenigstens ein neues Wunderkind her. Erzählt die langjährige Produzentin eines alteingesessenen deutschen Labels, das längst zum Warner-Konzern gehört: Sie legt jedesmal ihre Perlenkette ab, wenn sie zu Meetings geht. Denn es hört ihr keiner der Kollegen zu, wenn sie sich schon im Dresscode, quasi unter Verpackungsgesichtspunkten, zu den Underdogs von der Klassikabteilung bekennt und outet als ein auslaufendes Modell: als hoffnungslos veraltete "alte Klassiktante".
Ein kleines Piercing wäre also jedem klassischen Musiker zu empfehlen. Perfekt als Popmusiker tritt der junge chinesische Pianist Lang Lang auf, der so staunenswert blitzschnelle Finger hat, eine sympathische Clownsmimik und niedliche Kulleraugen, aber nur eine äußerst schmale Repertoirekenntnis. Sein Publikum liegt ihm zu Füßen. Auf der anderen Seite dieser Skala des Vermarktbaren, zufällig im gleichen Plattenkonzern Universal beheimatet, findet sich der ehemalige Decca-Pianist Alfred Brendel, der schon lange keine neue Aufnahme mehr vorgelegt hat, obgleich er doch ein fast ebenso ausgeprägtes Image hat. Brendels unverwechselbare Identität als Pianist wird äußerlich sichtbar in der Denkerstirne mit den Furchen, seine Waffe ist der Rückzug auf die kontemplative Versenkung. Brendel pflastert seine Finger, was als Sinnbild der inneren Distanz zu rein pianistischer Virtuosität zu lesen ist, ja, vielleicht sogar als subkutane Geste des Protestes.
Denn sind nicht die wahren Revolutionäre, jene, die gegen den Strom schwimmen, heute gerade unter den älteren Künstlern der klassischen Musikkultur zu finden? Tatsächlich sind die Zeiten längst Legende geworden, da die Frontlinie zwischen Popmusik und Klassik noch klar definieren werden konnte als Grenze zwischen der alternativ-revolutionären Jugendmusikkultur einerseits und der elitären, versteinerten Genußkultur des bürgerlichen Establishments andererseits.
Heute ist's genau umgekehrt: Die Popmusikindustrie bildet heute das Establishment. Nach ihren Gesetzen, also nach Maßgabe kommerzieller Effizienz, tagesaktueller Präsenz und Allgegenwärtigkeit, erotisch-aufgebrezelter Verpackung sowie dem Ideal ewiger Jugendlichkeit und immerwährender Pflicht zum Frohsinn hat sich auch die klassische Musik zu richten. "Dass eine derart wertvolle Tätigkeit wie die klassische Musikaufnahme am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts in sich zusammenfallen und ersetzt werden konnte durch die Schaumschlägerei kurzlebiger Prominenter, stellt einen immensen kulturellen Verlust dar, vergleichsweise einem Versinken Venedigs im Meer" jammert Norman Lebrecht. Er übersieht in seiner klassischen Weltuntergangsstimmung, dass sich die oppositionellen Kräfte längst sammeln, an der Basis, dort, wo das Musizieren noch gelehrt und das Musikhören wieder neu gelernt wird. Längst gibt es eine mobilisierte Betroffenenfront, etwa in den Workshops für "Schulen des Hörens" und in den Education-Projekten der Orchester und Opernhäuser, wo aufgrund der massiven bildungspolitischen Versäumnisse der letzten Jahrzehnte das Publikum ergraut ist und nicht mehr nachwächst. Kein Orchester, kein Opernhaus kann es sich noch leisten, auf Programme für Kinder zu verzichten. Educationprojekte sind Ehrensache. Doch so anrührend und vorbildhaft diese Projekte im Einzelnen auch sein mögen: Sie sind nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Von knapp zehn Millionen Schülern werden nur einige hundert erreicht. Was also fehlt, sind die auf Breite angelegten, bildungspolitischen Maßnahmen, private Projekte, Zivilcourage und phantasievolle Initiativen.
Wie Ernährungswissenschaftler die Tendenz zum Slow Food empfehlen, so gibt es jetzt schon Konzertveranstalter, die durch Kooperation, aber auch durch Heruntertunen der Umschlagszeiten wieder ein Klima der Kunstermöglichung herzustellen suchen. Es gilt, auch in bezug auf die Popstargagen wieder zurück auf den Teppich zu finden. Beispielsweise könnte ein Orchestermusiker etwa des Mozarteumorchesters in Salzburg von dem, was die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter für einen einzigen Auftritt verlangt (und auch bekommt), länger als ein gutes Jahr leben. Und gegen die fortschreitende "Verlärmung der Welt", die Inflation des musikalischen Geräuschs im urbanen Raum, wie sie der Soziologe Stephan Marks in seinem Buch "Es ist zu laut" (Fischer Verlag, 1999) beklagt, sind längst Tage der Stille eingeführt worden. Sie sollten nicht jährlich, sondern wöchentlich stattfinden. Denn auch das hat die verpopmusikalisierte Klassikindustrie den Hörern angetan. Schon nach wenigen Takten der g-moll-Symphonie von Mozart schalten die Ohren ab und unsere Wahrnehmung wird herabgesetzt auf eine diffuse Wohlfühlstufe. Abhängen, Träumen, Wegchillen, Entspannen, dem Alltag sich entheben, Farben oder Bilder sehen vor dem inneren Auge und mal auf ganz andere Gedanken kommen - das sind so etwa die landläufigen Idealvorstellungen davon, was ein Klavierrecital mit späten Schubertstücken oder ein Quartettabend mit Beethovens op. 130 im Zuhörer anzurichten hat. Ganz unvorstellbar wäre das gewesen für die Konzertgänger zu Lebzeiten dieser Komponisten, ein kulturhistorisches Mißverständnis, eine Beleidigung für das Stück ebenso wie für den Autor und die Interpreten.
Zur Zeit Beethovens und Schuberts, als noch in den meisten Bürgershaushalten ein Klavier herumstand, war das Musizieren noch eine elementare Kulturtechnik, so wie das Lesen, Schreiben, Rechnen, Tanzen und Dichten auch. Unter der Knute der klassischen Musikindustrie haben die meisten Musikliebhaber das Selbermusikmachen verlernt und nicht nur das: Sie verlernten darüber auch das Selbermusikhören. Vor den Museen bilden sich lange Schlangen halbwegs wacher Menschen, in den halbleeren Konzertsälen wird geschlafen und entspannt. Ja, selbst Kultursenatoren und führende Bildungspolitiker halten klassische Musik heutzutage für eine Art Lebensgarnitur, einen Wellness-Faktor oder ein kuscheliges Gemütsmäntelchen, das Wohlbehagen verschaffen kann, wie Wärme, Licht oder gutes Essen auch: "Toll" anzuhören, "zum Weinen schön." Solange dieser Irrtum nicht aus der Welt geschafft ist und auch die Kunst des Zuhörens wieder zu Ehren kommt, so lange werden weiterhin gute Tenöre schnell verheizt und mittelprächtige Pianisten zu Sternen aufgeblasen werden.
Von Eleonore Büning
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.08.2007, Nr. 191, S. Z1
Bilder und Zeiten
Alle Rechte vorbehalten. (c) F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Die von uns eingesetzten und einsetzbaren Cookies stellen wir Ihnen unter dem Link Cookie-Einstellungen in der Datenschutzerklärung vor. Voreingestellt werden nur zulässige Cookies, für die wir keine Einwilligung benötigen. Weiteren funktionellen Cookies können Sie gesondert in den Cookie-Einstellungen oder durch Bestätigung des Buttons "Akzeptieren" zustimmen.