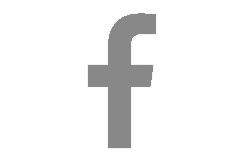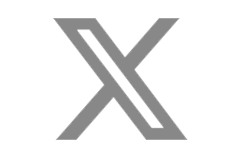Habe nun, ach, Schwein
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.06.2007, Nr. 145, S. 35
Feuilleton
Orgien in Plastik: Nitsch inszeniert an der Zürcher Oper Schumanns "Faust-Szenen"
ZÜRICH, 25. Juni
Das Schwein hat einen Reißverschluss. Von der Kehle bis zum After. So zahm geworden ist Aktionskünstler Hermann Nitsch, dass er bei seiner neuesten Bürgerschreckiade nur mehr ein wiederverschließbares Silikonschwein schlachtet. Es gibt sogar seitenweise Vorschriften dazu. Nie soll das Schwein an den Füßen aufgehängt werden. Mindestens zwei Mitarbeiter sind nötig zum Schließen des Schweins, Ersatzkunstschweine gibt es nicht. Dabei sind die Werkstätten der Oper Zürich nicht hoch genug zu loben für die meisterhafte Fabrikation allein dieses einzigen Schweins. Echt tot sieht es aus, durchs Opernglas betrachtet. Katharsisfördernd widerwärtig hingebungsvoll wühlt Dr. Faustus gut sieben Minuten lang in den Plastikdärmen herum, bis auch dem Gretchen am Ende übel davon wird. Bedrängt von Orgelklang und Gemeindegesang, ruft es nach dem Fläschchen der Frau Nachbarin.
Robert Schumann vertonte seine "Szenen aus Goethes Faust" wortwörtlich, ohne Abstriche. Doch die Szenenfolge ist wirr und widersprüchlich. Besagte "Szene im Dom", effektvoll opernmäßig aufgeheizt von Dies-Irae-Chromatik, entstand erst 1849, als eines der letzten Bruchstücke zu dem Werk. Fünf Jahre zuvor war in einem Wurf die großartige Schlussszene mit "Fausts Verklärung" aus "Faust II" entstanden, worin Engel- und Kinderchöre jubeln nebst Heiligen und Patriarchen. Unpraktisch viele Mitwirkende braucht das Stück. Selten wird es aufgeführt, oft gesagt, es sei ohnehin nur ein mehr oder weniger missratenes Fragment. Auf jeden Fall sprengen Schumanns "Faustszenen" jede bis dato bekannte Gattung. Dramatisch differenzierter als die biedermeierlichen Chor-Oratorien, gibt es andererseits zu wenig nummernfähige Handlung für eine Oper. Die Ouvertüre aber, die Schumann als Letztes notierte, trägt schon vorwagnerische Züge: eine aus wildem Paukenwirbel heraus sich aufbäumende, von Sequenz zu Sequenz taumelnde "Symphonische Dichtung", die mit einer Dissonanz beginnt und einmündet in trompetengellendes Dur. Entstanden ist sie 1853, der Krankheit abgerungen. Und wer weiß, vielleicht wäre doch am Ende das erste Bühnenweihfestspiel daraus geworden, hätte Schumann nur länger gelebt.
So, wie es ist, blieb es ein Schubladenstück, trotz seiner teils schattigen, teils grellen Schönheiten. Manchmal werden die "Faust-Szenen" für konzertante Aufführungen von den Liebhabern wieder herausgekramt, zuletzt von Claudio Abbado in Berlin 2002 und Sylvain Cambreling in Frankfurt 1994.
In Zürich indes, wo sie nun endlich auch szenisch auf die Opernbühne gelangen, ist Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst nur halb bei der Sache. Alles andere als spätromantisch klingt sein Orchester, eher lahm und unscharf in der Balance, ja ungewohnt grob in der dynamischen Gestaltung. Vielleicht ist Welser-Möst mit Kopf und Ohr schon unterwegs nach Wien. Die vereinigten Zürcher Opernchöre mit ihren vielen Chorsoli aber sind bestens präpariert, singen wuchtig, glanzvoll, gänsehauterzeugend. Und Simon Keenlyside ist ein starker, ausdrucksintensiver Faustus, der sich auch zurücknehmen kann ins zweifelnde Pianissimo. Elsa Giannoulidou blüht auf als Mater Dolorosa, Eva Liebau gibt der "Sorge" sinnlich-sinnige Züge, Günther Groisböck stellt mit seinem flexiblen Bass einen geradezu idealen Wanderer zwischen den Mephisto- und Pater-Profundus-Welten. Stimmlich angegriffen nur das brüchige Gretchen von Malin Hartelius, der nicht eben schlackenfreie Ariel von Tenor Robert Sacca.
Hermann Nitsch seinerseits, dem Hobby-Regisseur, ist in den zwölf Jahren, die seit seinem letzten Orgien-und-Mysterien-Opernversuch vergangen sind, nichts Neues mehr eingefallen. Klinisch weiß gekleidete Statisten hantieren mit Speeren und Stangen, wie einst 1995 an der Wiener Staatsoper bei Massenets "Herodiade". Zweimal nehmen sie den in Christuspose flachgelegten Faust vom Kreuz, waschen ihn und ziehen ihm ein frisches Kittelchen an. Zwei- oder dreimal laufen alle geordnet im Kreis herum. Einmal wirft sich der Kinderchor ornamentmäßig auf den Boden. Die Kleinen tragen wahlweise weiße Pyjamas (Engel) oder hautfarbene Badeanzüge (Lemuren), die Großen stecken sämtlich in längs- oder quergestreiften Hängerchen, die an die Op-Art-Mode der späten Siebziger erinnern. Diese regenbogenbunten Kreis- und Streifenmuster der Kleidung wiederholen sich an den Wänden, wo sie, computeranimiert, auf und nieder wandern. Mit Goethes Farbenlehre, wie Nitsch sich das so denkt, mag das auch entfernt zu tun haben: Grün bleibt grün. Doch setzt sich das strahlende Orange-Rot-Rosa-Gelb am Ende so flächendeckend durch, dass, als Fausts Verklärung näherrückt, auch Good old Poona wieder glücklich erreicht ist.
Im Programmheft bekennt Nitsch, der noch vor zwei Jahren bei seiner Burgtheater-Performance nicht an Kadavern gespart hatte, dass eine Originalschweinausweidung diesmal nicht möglich gewesen sei "aus hygienischen gründen, der macht der gesellschaftlichen tabus und ekelgründen". Flugs wird die Not zur Tugend: "dieses pattern zwischen neuem direktfunktionierenden aktionstheater und dem alten darstellenden theater" sei nichts anderes als ein neuartiges, "manieristisches projekt". Nun ist zwar das Musiktheater nicht neu erfunden an diesem Abend. Aber die schöne Schweiz blieb sauber.
ELEONORE BÜNING
Die von uns eingesetzten und einsetzbaren Cookies stellen wir Ihnen unter dem Link Cookie-Einstellungen in der Datenschutzerklärung vor. Voreingestellt werden nur zulässige Cookies, für die wir keine Einwilligung benötigen. Weiteren funktionellen Cookies können Sie gesondert in den Cookie-Einstellungen oder durch Bestätigung des Buttons "Akzeptieren" zustimmen.