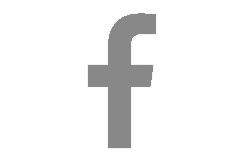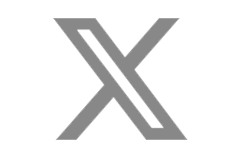Lauer Sommer der Goethe-Liebe
DIE WELT, 26.06.2007, Nr. 146, S. 29
Ressort: FEUILLETON
Manuel Brug
Der Künstler Hermann Nitsch bringt in Zürich Schumanns "Faust-Szenen" auf die Opernbühne
Von Manuel Brug
Das Schwein hatte schon bald seinen großen Auftritt. Szene im Dom, natürlich, aus Goethes "Faust I", vertont von Robert Schumann. Aber eigentlich ist für Hermann Nitsch, den österreichischen Mysterienmeister, den jüngst mit eigenem Museum zum Klassiker gesalbten Herren über tote Tiere, Blut und Gekröse, ein Schwein viel zu wenig. Und richtig antiklerikal orgiastisch, blasphemisch gar, wird es mit dem ausgenommenen, dabei auf zwei Projektionsflächen videoübertragenen Borstenvieh erst gar nicht, kann es gar nicht werden.
Es ist nämlich aus Plastik. So wie auch die Därme und anderen Innereien aus Silikon sind. Immer aufs Neue werden sie hineingestopft, mit dem besonderen Saft Kunstblut übergossen, um anschließend heraus zu glibbern und zu knatschen. Im Foyer des Zürcher Opernhauses erklären dessen Werkstätten übrigens in einer eindrucksvollen Installation stolz, dabei eidgenössisch sachlich, deren Herstellung und Handhabung. Es gibt sogar ein Herz zum Anfassen.
Jenes freilich ist konkreter, dabei genauso geheimnislos wie die Aktionen, die sich im Graben und auf der Bühne ereignen. Im Rahmen ihres Festspiel-Saisonabschlusses zeigt Alexander Pereiras wunderbare Jahrmarktsbude, eingeklemmt zwischen Mozart für Kinder, Zandonais Verismo-Schmachtfetzen "Francesca da Rimini" und dem Alban Berg Quartett, die wohl noch nie Bühnenlicht gesehen habenden, von ihrem Schöpfer durchaus aber dafür vorgesehenen "Szenen aus Goethes Faust": jenes schmerzensreiche, zu keinem Ganzen sich fügen wollende, mit vielen schönen, sanft nazarenerhaften Details aufleuchtende Chor-, Orchester und Solisten-Unikum Robert Schumanns, das nicht Oper und nicht Oratorium ist, nicht mehr Kantate scheint. Benjamin Britten und Claudio Abbado hatten eine große Liebe für dieses so ganz und gar romantisch fragmentarische, mehr mit der "schrulligen Ungenießbarkeit" (Thomas Mann) des zweiten "Faust"-Teils denn der populären, auch für die Opernbühne gern und oft ausgeschlachteten Gretchen-Tragödie hantierende Ding tonschöpferischer Unmöglichkeit. Und auch Franz Welser-Möst schätzt es sehr.
Das wurde deutlich in den ausgreifenden, schattiert ziselierten Chorpartien für die Kleinen und Großen, die Ernst Raffelsberger vorzüglich einstudiert hat. Spielte das Orchester endlich zusammen, auch in vielen feinen, hell scheinenden Momenten. Doch fanden sich allzu viele matte, bis blinde Stellen, Ungenauigkeiten. Schumanns schwierig handhabbare Instrumentation erfuhr mitunter einen Hang zum Strohig-Pelzigen; es klang oft flach, ja höchstens pflichtschuldig.
Die Szene fing das nicht auf. Sicher hatte keiner vom alten, in aktionistischen Ehren ergrauten Hermann Nitsch plötzlich wegweisendes Regietheater erwartet. Bereits vor Jahren hatte er an der Wiener Staatsoper in Massenets Salome-Oper "Herodiade" ein wenig Kunstblut über weiße Leinwände schütten und laufen lassen. Doch etwas schmuddeliger, wagemutiger hätte man sich diesen raren, gemeinsam mit Andreas Zimmermann visualisierten Schumann-Goethe schon gewünscht. Eben mit mehr Schwein! Statt Zürisee de Luxe.
So wurde man ungläubig Zeuge eines gepflegten Blutsturzes als nostalgisch harmlose, ganz und gar keimfreie Nitsch-Reminiszenz an den Sommer der Liebe. Goethe im Grasrausch, wo man freudvoll die Sonne hereinscheinen lässt und - mal im bunten Streifenhängerchen, mal im kleinen Hautfarbenen - in seliger Chorekstase eurythmisch trippelt.
Und wir entdeckten: Es steht inzwischen ein Graphikcomputer im Nitsch-Schloss Prinzendorf. Darauf kann man poppige TV-Testbilder kreieren, blubbernd Kreise auf- wie zugehen lassen und Werbefotos von der Wachau, vom Veltliner oder von barocken Schnörkelbauten laden und auf drei bühnenfüllenden Leinwänden übereinander kopieren. Mehr inszenierte Farbenlehre denn Faust. Ästhetisch auf jeden Fall als Anthroposophen-Ticket nach Dornach, zu den dortigen integralen "Faust"-Bemühungen in Goethes Namen, unbedingt kompatibel.
Charaktere fanden in diesen statischen, von allzu langen Umbaupausen unterbrochenen sieben Szenen in drei Teilen als Mischmasch aus salbungsvoller "Zauberflöten"-Gespreiztheit und Fernsehprediger-Hosanna nicht wirklich statt. Also konzentrierten sich die Sänger auf das ihnen Eigentliche. Marlin Hartelius, deren einst zarter Sopran immer mehr in Einzelteile zerfällt, barmte als Gretchen schwarzgewandet an der Rampe. Robert Saccà hing als Ariel tenortrompetend vor einem Fototapeten-Kosmos in den Seilen und bediente als Pater Profundus souverän schwebend sein Fliwatüt.
Eva Liebau verschönerte sogar die Sorge mit ihrem Vokalschimmer. Der quergeringelte Mephisto Günther Groissböcks hatte optisch höchstens Stofftier-Charme, sang aber mit balsamisch biegsamer, genau kanalisierter Bassfülle. Und erst Simon Keenlyside! Wenn der sich nicht gerade waschen oder in Blut tränken lassen, ewig an- und ausziehen, aufs Kreuz oder auf Tragen legen lassen, gen Himmel und auch wieder abwärts fahren musste, dann wurde der gegenwärtig intelligenteste Bariton beinah lässig, dabei auf jede Nuance hoch konzentriert seinem Ruf mehr als gerecht: Er prunkte stimmlich und sezierte gleichzeitig nachdrücklich den Text. Dr. Faustus Superstar, fast mönchisch seiner Sendung zugewandt.
Die schönste Szene ereignete sich freilich permanent und parallel zur blässlich lauen Aufführung im Zuschauerraum. Da thronte die barocke Gestalt Hermann Nitschs sanftmütig lächelnd als wohlwollender Gottvater mit akkurat gestutztem Vollbart, erst in der Proszeniumsloge Mitte links, dann in der des Intendanten, über allen und allem und segnete gedanklich ihre jüngste Schöpfung.
Die von uns eingesetzten und einsetzbaren Cookies stellen wir Ihnen unter dem Link Cookie-Einstellungen in der Datenschutzerklärung vor. Voreingestellt werden nur zulässige Cookies, für die wir keine Einwilligung benötigen. Weiteren funktionellen Cookies können Sie gesondert in den Cookie-Einstellungen oder durch Bestätigung des Buttons "Akzeptieren" zustimmen.