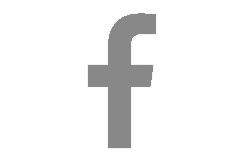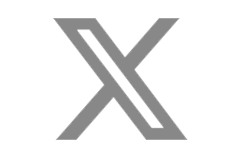Durchbruch zur Höllenfahrt
Die kommentierte Neuausgabe von Thomas Manns «Doktor Faustus»
5. Januar 2008, Neue Zürcher Zeitung
Im Rahmen der Grossen Kommentierten Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns ist nun der Roman «Doktor Faustus» aus dem Jahr 1947 erschienen. Mit dem Kommentarband erhält der Leser zugleich ein gewichtiges Thomas-Mann-Lexikon in die Hand.
Von Manfred Koch
Nach jedem Roman musste Thomas Mann Versöhnungsbriefe schreiben. Freunde und Bekannte, die sich in bestimmten Figuren porträtiert fanden, waren irritiert, gekränkt oder aufrichtig empört. Vor allem die Veröffentlichung von «Doktor Faustus» (1947) zog erhebliche Aufräumarbeiten nach sich. Gutmütige Weggefährten wie Hans Reisiger (der Rüdiger Schildknapp des Romans), Ida Herz (Meta Nackedey) und Emil Preetorius (Sixtus Kridwiss) waren leicht zu beruhigen. Der konzilianten Art des Nobelpreisträgers, der im Tagebuch durchaus befriedigt festhielt, er habe literarische «Morde» an ihnen begangen, hatten sie auf Dauer nichts entgegenzusetzen. Seinen musikalischen «Berater» – und de facto Co-Autor – Adorno, den er als bebrillten Teufel verewigt hatte (was der nicht übelnahm), würdigte er durch den Roman zum Roman «Die Entstehung des Doktor Faustus».
Arnold Schönbergs Ärger
Am aufreibendsten gestaltete sich die literarische Diplomatie da, wo Mann gar keinen Konflikt erwartet hatte. Arnold Schönberg entrüstete sich zunächst über die Aneignung seiner Zwölfton-Technik durch den Romanhelden Leverkühn, worauf der Autor ihn in den weiteren Ausgaben als eigentlichen Erfinder dieser Kompositionsart ausdrücklich nannte. Dadurch sah Schönberg sich nun aber «personifiziert» in einem Syphilitiker und Wahnsinnigen. Die briefliche Aussöhnung gelang nur, weil Schönberg zur Entlastung Thomas Manns seine gesammelte Wut auf Adorno richtete, den führenden Philosophen der neuen Musik also paradoxerweise zum Hauptverantwortlichen für deren seltsame Diabolisierung in diesem Buch machte.
Hätte Schönberg den «Doktor Faustus» mit Hilfe des Kommentars der neuen Frankfurter Thomas-Mann-Ausgabe studieren können (er hat den Roman vermutlich nie ganz gelesen), wäre ihm sofort aufgefallen, in welchem Mass Adrian Leverkühn selbst eine komponierte, wörtlich: zusammengesetzte Figur ist, die mit seiner Biografie nichts und mit seiner musikgeschichtlichen Stellung weniger, als man denkt, zu tun hat. «Montage» ist nach Manns eigener Aussage ein wesentliches Konstruktionsprinzip des Romans. Der Kommentarband von Ruprecht Wimmer und Stephan Stachorski trägt auf über 1200 Seiten die Bausteine zusammen. Er stellt die musikwissenschaftlichen, kulturgeschichtlichen, medizinischen, philosophischen und theologischen Quellen vor, die Mann, zum Teil wörtlich, eingearbeitet hat, erklärt die Anspielungen auf Prätexte aus der Literatur, der Mythologie, der Politik und erläutert den biografischen Hintergrund sowie die Genese des Romans.
Dank dem Personen- und Werkregister am Ende lässt sich der Band nicht nur als Verständnishilfe bei der Romanlektüre, sondern auch als Thomas-Mann-Lexikon verwenden: ein Nachschlagewerk zum «Faustus», das den Blick freigibt auf Konstanten des Gesamtwerks. Wenn eines Tages alle Kommentarbände der Frankfurter Ausgabe vorliegen, verfügen die Thomas-Mann-Forscher und -Enthusiasten über eine gewaltige, konkurrenzlos genaue und durch die Fülle der Querverweise extrem inspirierende Enzyklopädie zu ihrem Autor.
Wer Roman und Kommentar parallel liest, kann die «Montage» des Helden Leverkühn Stück für Stück nachvollziehen. Das Grundgerüst liefert die Biografie Nietzsches (weshalb der Name Nietzsche nirgendwo auftaucht). Adrian trägt aber auch Züge der Tonsetzer Robert Schumann und Hugo Wolf (zwei weitere geniale, am Ende wahnsinnig gewordene Syphiliskranke), er ist selbstredend der Magier des Faust-Volksbuchs, er spricht das Deutsch Luthers und Grimmelshausens, wurzelt topografisch im Kerngebiet der Reformation und künstlerisch in der raffinierten protestantischen Rauschmusik eines Johann Sebastian Bach. Und er ist – das macht das Befremdliche des Buchs aus – in alledem sowohl eine Identifikationsfigur für den Autor Thomas Mann als auch eine Allegorie des faschistischen Deutschland.
Wie dies zusammengehen soll, ist die Frage, die seit 60 Jahren ein wachsendes Heer von «Faustus»-Interpreten umtreibt. Schon die ersten Rezensenten waren ratlos. «So schillert», schreibt Ludwig Marcuse 1948, «Adrian ein wenig faschistisch und das Dritte Reich ein wenig genialisch». Da ihm beides unausdenkbar scheint, schreckt Marcuse gleich wieder zurück: «Das hat Thomas Mann bei Gott nicht gewollt.» Thomas Mann gibt in einem Brief an Tochter Erika aus demselben Jahr aber durchaus zu verstehen, dass er so etwas gewollt hat, auch wenn ihn das Herumreiten der Kritiker auf dem Parallelismus von Künstlerfuror und deutschem Wahn enerviert: «Nur dass alle die d-e-u-t-sche Allegorie so fürchterlich hervorkehren. Bin ja selber schuld. Weiss es.»
Zwar soll ein Kommentar keine Deutung vorgeben, an diesem zentralen Punkt, der eine interpretierende Stellungnahme förmlich erzwingt, hätte man sich von den Herausgebern aber einen mutigeren Zugriff gewünscht. Auf der einen Seite stellen sie alles Material zusammen, das auch über den Romantext hinaus belegt, wie insistierend Mann die musikalische Eingebung mit der «fatalen Inspiration» Nazideutschlands verknüpft. Die Geburt der neuen Musik aus dem Geist der Leverkühnschen Syphilis wird, daran besteht kein Zweifel, mit dem deutschen Vorstoss in fremde europäische Regionen analogisiert.
Franz Kafka hat die Rede vom «künstlerischen Durchbruch» ihrer kriegerischen Herkunft wegen abgelehnt; eine «Hindenburgangelegenheit» nannte er diese Metapher geringschätzig. Thomas Mann hingegen baut, wie Wimmer/Stachorski zeigen, seinen Roman bewusst auf diesem Doppelsinn von «Durchbruch» auf. Was hilft hier der Hinweis, es gehe nicht an, «im Tonsetzer lediglich die Allegorie des schuldig gewordenen Deutschland» zu sehen, verbunden mit der Forderung, die «relativierenden» Stellen stärker zu beachten? Sehr viel mehr als die Binsenweisheit, dass im Umgang mit Literatur jede Vereindeutigung von Übel ist, kommt dabei nicht heraus.
Nihilismus der modernen Kunst
«Doktor Faustus» belegt, dass Thomas Mann bis ins hohe Alter seine Kunst unter Pathologieverdacht gestellt hat, selbstbewusst und ängstlich zugleich. Es ist der abgründige Komplex von Musikalität und homoerotischer Verführung, aus dem sein Schreiben jene wilden Energien bezieht, die der Sprachartist kühl berechnend in wohlgefügte Prosa überführt. In dieser Konstellation sah Mann grundsätzlich auch das «Böse» der autonom gewordenen modernen Kunst. An ihren beiden Polen – des rauschhaft hitzigen Ur-Antriebs auf der einen und des kalten Formkalküls auf der anderen Seite – hat Kunst mit Moral nichts im Sinn. Dass Thomas Mann es gewagt hat, diesen Nihilismus der modernen Kunst mit dem praktizierten Nihilismus der Nationalsozialisten zu verbinden, das Dionysische der eigenen protestantischen Seele und die Todestrunkenheit des Luther-Volks, der «musikalischen Nation» Europas schlechthin, allegorisch ineinander zu spiegeln, macht das ewig brisante Skandalon des «Doktor Faustus» aus.
Thomas Mann: Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Text und Kommentar. Herausgegeben und textkritisch durchgesehen von Ruprecht Wimmer unter Mitarbeit von Stephan Stachorski. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007. 740 u. 1270 S., Fr. 139.–.
Die von uns eingesetzten und einsetzbaren Cookies stellen wir Ihnen unter dem Link Cookie-Einstellungen in der Datenschutzerklärung vor. Voreingestellt werden nur zulässige Cookies, für die wir keine Einwilligung benötigen. Weiteren funktionellen Cookies können Sie gesondert in den Cookie-Einstellungen oder durch Bestätigung des Buttons "Akzeptieren" zustimmen.