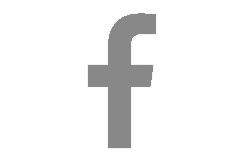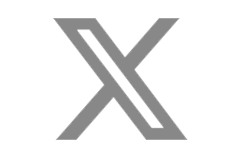Ein lupenreiner Engel gerät ins Zwielicht
Nikolaus Harnoncourt und Martin Kusej mit Robert Schumanns einziger Oper "Genoveva" in Zürich
Von Heinz W. Koch (Stuttgarter Zeitung, 19.02.2008, S. 25)
Die "Neuerfindung der Oper" - ein großes Wort. Nikolaus Harnoncort münzt es auf Robert Schumanns einziges Bühnenwerk, auf die 1850 in Leipzig uraufgeführte "Genoveva", einen vom Komponisten größtenteils selbst angerichteten Mix aus Vorlagen von Tieck und Hebbel. Jetzt endlich fand sich auch ein Haus, an dem der unterdessen 78-jährige Dirigent seine These erhärten konnte. Es ist die aufs Durchforsten der Raritätenecken fast schon abonnierte Zürcher Oper, und Martin Kusej ist der Szeniker, den der Musiker immer schon herbeisehnte.
"Neuerfindung der Oper"? Vielleicht. Sicher ist jedoch, dass wir es, trotz öfter schwächelnden Orchesters, von der schmerzlich ausgereizten Eröffnungsdissonanz an mit einem Schumann-Nonplusultra zu tun haben. Mag Harnoncourt auch hier gelegentlich mit erhobenem Zeigefinger dirigieren, ist es doch schwer vorstellbar, dass jemand die Spezifika dieser "Genoveva" überzeugender, dringlicher hervorkehrt als er: diese Mischung aus sinfonischem Überbau und Singspiel, aus schier Bach'scher Choralkunst und romantischem Opernschauer mit Vokalstrecken darin, in denen Schumann sich als großer Liedmeister artikuliert. Im Grunde wird ihm alles zum Arioso, zum tönenden Dauerfluss, zum gerade auch orchestralen Strom ohne Ende. Und das Ganze ist aus einem einzigen Motivkeim entwickelt.
Dass das keineswegs ohne Punkt und Komma dargeboten werden muss, auch das beweist dieses Interpretationsmuster. Sicher befeuert Harnoncourt Schumanns unaufhaltsamen musikalischen Sog, modelliert er aufs Sorgsamste die Überleitungen, aber er verschluckt eben auch die Stauungen, die Zäsuren, das Atemholen der Musik nicht. Im Gegenteil, er schärft die Ingredienzien und meidet eine Generalgefahr bei Schumann: den Klangbrei. Wenn das Werk in der grölenden Sauferei im Schlosshof dann zu fast Berlioz'scher Drastik vorstößt, treibt auch Harnoncourt die Farben ins Grelle. Dabei ist es immer, als dringe die Musik ins Innere der Gestalten vor, als belausche sie ihre Seelen.
Genoveva von Brabant ist ein Engel. Während ihr Gatte, der Pfalzgraf Siegfried, gegen die Mauren in den Krieg zieht, führt sie daheim einen lupenreinen Lebenswandel. Der in sie vernarrter Golo, der sie eigentlich beschützen soll, kommt partout nicht ans langersehnte Ziel. Aus Rache bugsiert er den ahnungslosen Haushofmeister dahin, wo dieser absolut nichts verloren hat: in ihr Schlafgemach. Entdeckung, Kerker, Beinahehinrichtung, indes auch Reue der Verleumder, Happy End in letzter Minute, jede Menge "Heil!"-Rufe.
Die Inszenierung hält es mit den musikalischen Erkenntnissen, sie widmet sich ganz dem Inneren der Gestalten. Kusej vollzieht nach, was Harnoncourt immer schon predigte: Nichts ist hier real, nichts "Wirklichkeit". Rolf Glittenberg richtete ihm dafür eine Bühne auf der Bühne ein: einen blendend weißen Kasten, ein paar - mehr und mehr blutverschmierte, verschmutzte, "befleckte" - Quadratmeter, in denen die Figuren regelrecht ausgestellt sind. Darin Verkrampfte, Gekrümmte, Wankende, zu Boden Gedrückte, an den Rand Gedrängte, am Ende Verwüstete, in eine hochkünstliche, manieristisch-expressive Choreografie der Haltungen, Gebärden und verborgenen Wünsche eingebunden.
Das ist sehr gewagt. Aber es verfängt, in seiner Dichte, seiner kompromisslosen Ernsthaftigkeit, seiner Suche - schreibt der Zürcher Germanist Peter von Matt - nach dem Abgrund "hinter den naiven Umrissen". "Du bist ein deutsches Weib, so klage nicht": der Pfalzgraf, Repräsentant der starren Ordnung, vertritt die 1847/48 revolutionär erschütterte alte Welt. Kein Zweifel, dass der Literat in Schumann den oft belachten reaktionären Phrasenmüll brandmarkte.
Nur selten, dass die Außenwelt in den Kosmos der vier Zentralgestalten eindringt: als aufrührerisch-anonyme Chormasse mit geschwärzten Gesichtern, als unumgängliche Staffage der brodelnden Gerüchteküche, der Schergen. Für den Fortgang wichtige Briefe wollen schließlich überbracht werden. Kusej fängt die unheile Welt der geknebelten Biedermeiergesellschaft (Kostüme: Heidi Hackl) ein - und ihre Zerrissenen, Gespaltenen, wie Schumann selber einer war. Die stark geforderten Sängerdarsteller lassen sich ohne Rückhalt auf das gewagte Konzept ein. Voran Juliane Banse, blühender Sopran mit erfülltesten Momenten, in der Titelpartie. Shawn Mathey als Golo ist ein offener, differenzierter Tenorlyriker, Martin Gantner mit makellos formulierendem tenoralem Bariton singt den Siegfried, Cornelia Kallisch als Zauberhexe Margaretha scheint jetzt doch über ihren Zenit hinaus zu sein. Demonstrativer Applaus, einige Buhs.
Weitere Aufführungen heute und am 21., 23., 26., 28. Februar sowie am 2. und 4. März