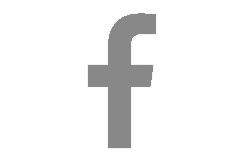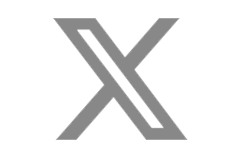Nicht für unsere Zeit
Neue Zürcher Zeitung 26.06.2007, Nr. 145, S. 43
Feuilleton
Alfred Zimmerlin
Das Fernsehen war da, um für die nächste Tagesschau Bildmaterial von einem allfälligen Skandälchen zu haben. Hermann Nitsch, Wiener Aktionist der ersten Stunde, Schöpfer des sogenannten Orgien-Mysterien-Theaters, eine barocke Figur wie aus einer andern Zeit, hat am Zürcher Opernhaus die «Szenen aus Goethes Faust» von Robert Schumann ausgestattet und - zusammen mit dem jungen und noch wenig erfahrenen Schweizer Regisseur Andreas Zimmermann - inszeniert. Eine Festspiel-Premiere, die für den Boulevard offenbar Skandal-Potenzial hatte. Doch wie will ein Nichts skandalisieren? Wie soll eine Inszenierung, die uns Menschen von heute an keinem Punkt berührt, weil sie uns offensichtlich nicht betrifft, mehr als ein Gähnen provozieren? Doch der Reihe nach, denn da ist die Musik. Und die ist grandios.
Musikalische Grosstat
Schumann hat in seinen «Faust-Szenen» in drei Abteilungen einige Kernszenen aus Goethes «Faust I» und vor allem aus «Faust II» für Soli, Chor und Orchester vertont. Keine Oper, kein Oratorium, ein Monolith. Es ist ihm nichts Geringeres gelungen, als den schon damals schwer zugänglichen «Faust» musikalisch in die Sprache seiner Zeit - die Goethe noch nahe war, man feierte den hundertsten Geburtstag des Dichters - zu übersetzen. Dabei hielt er sich genau an Goethes Text. Superb, wie das Orchester der Oper unter der Leitung von Franz Welser-Möst in die Ouverture einsteigt und einen vom ersten Ton an elektrisiert. Genau und hochdramatisch wird hier die Spannung aufgebaut, im Aufbäumen der Gesten ist die so gegenwärtige Körperlichkeit der Musik förmlich zu spüren.
Welser-Möst hat einen kräftigen, aber differenzierten Zugriff auf die Partitur, mischt die Farben wunderbar, zeigt alle dynamischen Kontraste genau. Auch in den Szenen selber sucht er immer den leidenschaftlichen Ausdruck im Detail, ohne das Gespür für die Dramaturgie des Stücks zu verlieren. Der Klang ist durchsichtig, die Akzente werden präzise aufeinander abgestimmt gesetzt, die (eher ruhigen) Tempoverläufe wirken organisch. Im vergangenen April hat Welser-Möst das Werk bereits konzertant mit derselben Besetzung in der Tonhalle Zürich aufgeführt. Seine Interpretation hat unterdessen enorm gewonnen; jetzt ist alles durchhörbar.
Dann die Chöre: Ernst Raffelsberger hat sie vorbereitet. Der Chor des Opernhauses und seine Soli, der Opernhaus-Zusatzchor, der Jugendchor und der Kinderchor singen ihre ausgiebigen Passagen wunderschön, eingebettet in einen Orchesterklang, der sie trägt. Und die Soli: Wunderbar die Intensität und die Plastizität, die Simon Keenlyside dem Gesang des Faust gibt. Malin Hartelius ist ganz in die Rolle des Gretchens hineingewachsen und singt mit einer Differenziertheit sondergleichen. Herrlich der Bass von Günther Groissböck, der den Mephisto, den bösen Geist und den Pater Profundus mit eindringlichen Farben ausstattet. Etwas weniger glücklich passt sich das vibrierende Timbre von Roberto Saccàs Tenor (Ariel und Pater Ecstaticus) in Schumanns Musik ein, aber singen kann auch er. Und die Nebenrollen kommen mit Elsa Giannoulidou, Eva Liebau, Martina Welschenbach, Kismara Pessatti, Katharina Peetz und Ruben Drole bestens zur Geltung. Eine musikalische Grosstat also, und ein Ereignis, diese aufwendige Rarität überhaupt hören zu können.
Was nun tun Hermann Nitsch und Andreas Zimmermann? Nitsch breitet mit Projektionen Goethes Farbenlehre aus. In der ersten Abteilung wird noch etwas konkreter bebildert, dann zunehmend abstrakter mit Linien und Kreisen.
Statische Bilder
Die Wirkung ist die eines Zufallsgenerators, der sich durch den Farbenkreis zappt. Auch die Figuren auf der Bühne werden mit ihren bunten, geschlechtsneutralen, sackartigen Gewändern zu Farbträgern. Die Striche und Kreise des Hintergrundes werden darauf verdoppelt, alles Menschliche ist abwesend. Eine Folge von statischen Bildern entsteht mit langen, für die Dramaturgie des Werkes schädlichen Pausen zwischen den Szenen. Die Bilder sind zu Beginn immerhin noch hübsch, werden aber zunehmend öd und redundant. In Szene drei - Gretchen wird beim Requiem für ihre Mutter im Dom vom bösen Geist bedrängt - wird auf einem Altar von Faust und einigen Aktions-Assistenten ein Plasticschwein aufgeschlitzt, ausgeweidet, wieder gefüllt . . . Da ist das Tieropfer, das zum «Orgien-Mysterien-Theater» gehört und Katharsis auslösen soll. Aber es wirkt aufgesetzt, ist für das Stück völlig überflüssig. Immerhin ist es das einzige Mal, wo auf der Bühne überhaupt etwas geschieht.
Denn im Übrigen herrscht eine schier unerträgliche Statik. Die Figuren stehen entweder vorne an der Rampe oder schreiten langsam auf diese zu. Bewegung wird auf ein Minimum beschränkt, und sie ereignet sich nur an der Peripherie der Personen, denen jedes Zentrum weggenommen ist. Es gibt ein wenig Auf und Ab mit den Armen, die vorzugsweise zur Kreuzhaltung ausgestreckt werden, es gibt einige oft symmetrische Gruppierungen auf der Bühne, sonst findet Personenführung nicht statt.
Abgeschmackt
Der Inhalt der Bilder schliesslich verdoppelt Goethes Text. Und meist lässt sich die Regie von dessen originalen Bühnenanweisungen (und denen Schumanns) inspirieren, mit einem heute mitunter abgeschmackten Resultat: Das Schweben des Paters Ecstaticus zu Beginn der dritten Abteilung ist von Schumann (und etwas gemildert von Goethe) verlangt; Roberto Saccà, der auf seinem an Seilen aufgehängten, sich auf und ab bewegenden Stuhl in Kreuzeshaltung singen muss, tut einem leid. Da hätte die Regie eingreifen und die Lächerlichkeit des Bildes korrigieren müssen.
Nein, das war keine gute Idee, Hermann Nitsch für die «Faust-Szenen» zu engagieren. Von Gesamtkunstwerk keine Spur, denn gerade die Verdoppelungswut erstickt den Ansatz dazu im Keim. Die Inszenierung dient nicht Goethes Text, der uns heute durchaus noch etwas geben könnte, falls er entsprechend umgesetzt würde. Sie dupliziert und neutralisiert ihn. Die Inszenierung zelebriert nicht das Theater, denn sie entmenscht es. Alles ist voraussehbar. Und mit ihrer Grellheit hindert sie einen daran, wenigstens aufmerksam der Musik zu folgen. In der Musik nämlich steckt unendlich viel mehr als in den Bildern, welche kaum einen zusätzlichen Erkenntniswert anbieten. Welche Menschlichkeit, welche Körperlichkeit könnte man bei Schumann finden. Nitsch ist mit seinem uns fernen Ritual in seiner seltsamen anderen Zeit stehengeblieben.