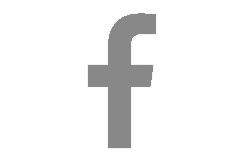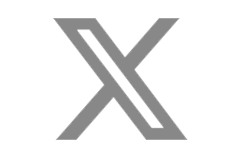Opernraritäten: „Genoveva“ wirkt, Zürich weiß das jetzt
WILHELM SINKOVICZ (Die Presse, 19.02.2008)
Martin Kusej und Nikolaus Harnoncourt bringen Schumanns einzige Oper auf die Bühne – aufregend und fesselnd.
"Unaufführbar", hieß es über die Jahrhunderte. Robert Schumanns Oper über die Hl. Genoveva galt als völlig undramatisch, als Versuch einer Erneuerung der deutschen Oper restlos misslungen. Ganz falsch, sagt Nikolaus Harnoncourt, der ein Faible für diesen musikdramatischen Solitär hat und ihn konzertant und für CD öfters realisiert hat. Nun hat sich der Dirigent einen Herzenswunsch erfüllt: Im Zürcher Opernhaus kam es zu einer szenischen Produktion. Martin Kusej inszenierte – und das Publikum befand zuletzt, das sei ein besonderes Erlebnis gewesen.
Als undramatisch oder gar langweilig empfand die Aufführung gewiss keiner. Und das, obwohl der Regisseur darauf verzichtet hat, großes Ausstattungstheater zu machen. Im Gegenteil. Kusej reduziert „Genoveva“ aufs Seelendrama, stellt die Figuren als Symbole innerer Zerrüttung, unausgesprochener Wünsche, verdrängter Sehnsüchte ins kahle, weiße Zimmer, das Rolf Glittenberg auf die schwarz umrandete Bühne gestellt hat.
Die Wände nutzt Kusej für Blut- und Schmutz-Schmieraktionen Marke Hermann Nitsch, ein Waschbecken findet sich als karges Interieur auch, auf dem hocken oder stehen die Darsteller in besonderen Momenten. Auch Christoph Marthalers Ästhetik spukt also im freizügigen Assoziationstheater, dem Kusej noch einige völlig unnötige stumme Verzögerungsmomente und eine „inszenierte“ Ouvertüre beigesellt, in dem die Hauptpersonen vorgestellt werden. Zur Musik aber setzt er sein kräftiges, wenn auch distanziert stilisiertes Aktionstheater, das uns die Befindlichkeiten der Figuren so drastisch vor Augen führt, wie Schumanns Musik sie hörbar werden lässt.
Radikaler Traum von moderner Oper
Damit gelingen Kusej fesselnde Parallelaktionen zu Harnoncourts aufregender Dechiffrierung der Partitur – das Zürcher Orchester, nicht immer präzis, aber mit sympathischem Hochdruck an der Umsetzung von Harnoncourts Vorstellungen arbeitend, ist dank vieler Begegnungen mit diesem Interpreten vertraut mit historischen Spielpraktiken und lässt hören, wie radikal, wie unkonventionell, wie modern Schumann seinen Traum einer neuen Musikdramatik umgesetzt hat.
Schon die ersten Takte der Ouvertüre schockieren mit grellen Dissonanzwirkungen, die bösen Mächte, deren Wirkung die Triebkraft des Dramas bilden, haben ihre sinistren Klänge, kühne Instrumentationseffekte mit aggressiven Tönen aus extremen Registern – und nur die Heilige Genoveva selbst hat liedhaft-schlichte, anrührende Melodien zu singen, die von Juliane Banse mit einer Innigkeit und Leuchtkraft zu bewegendem Bühnenleben erweckt werden.
Die Zentralgestalt des Dramas, rein und keusch auch im Moment der äußersten Anfechtung, erhält durch Banse optisch wie akustisch raumfüllende Dimension. Dem können die Kollegen nicht allesamt genügend Kunstfertigkeit entgegensetzen: Martin Gantner gibt mit etwas zu wenig Kraft in der Tiefe, aber so recht stolz und edel den christlichen Kämpfer Siegfried, der sein Heer gegen die Muselmanen führt und nach erfolgreicher Schlacht erfahren muss, dass sein Weib nicht treu war, wie er dachte – eine Verleumdung, wie sich im allerletzten Moment herausstellt.
Daran scheitert die Rache des abgewiesenen Möchtegernliebhabers Golo. Ihn singt mit etwas zu leichtgewichtigem, aber schön modellierendem Tenor Shawn Mathey; zur bösen Tat angestachelt durch die Personifikation seiner Triebe, die Amme und Hexe in Personalunion, Margaretha: Cornelia Kallisch lässt, scharfstimmig geworden, aber unerhört präsent, keinen Zweifel an der Wirkungsmacht dieser erstaunlichen Mischung aus Azucena und Kundry.
Alfred Muff dazu, glänzend bei Stimme, als später Erbe von Mozarts „steinernem Gast“ – ihn verdächtigt die aufgebrachte Rotte des Ehebruchs mit der in Wahrheit keuschen Genoveva. Ein Scherge richtet ihn hin, ehe er die Situation aufzuklären vermöchte. Kusej nützt derlei Momente zu Blutorgien, findet aber im Übrigen zu dezent stilisierten, doch unmittelbar beeindruckenden Tableaus.
Harnoncourt steigert die von Schumann genial bruchlos getürmten Szenenfolgen zu eminenten Höhepunkten. Und der Zürcher Chor hält sich in den – erstaunlich gebremst musizierten – religiösen Chorälen, vor allem aber in den Sieges- und Spottgesängen tadellos: Dass dieselbe, schmutzig gewandete und wie Kohlearbeiter geschminkte Arbeitermeute, die vorgeblich friedvoll den lieben Gott besingt, Genoveva geifernd des Ehebruchs überführen will, daraus bezieht das gar nicht altmodische Drama seine unmittelbare Schlagkraft. „Genoveva“ wirkt. Zürich weiß das dank Nikolaus Harnoncourt jetzt ganz genau.
ZUR ZÜRCHER GENOVEVA
Robert Schumanns einzige Oper, geschrieben 1847/48, steht im Zürcher Opernhaus noch am 17., 21., 23., 26., 28.Februar sowie am 2. und 4.März auf dem Programm.
Besetzung: Dirigent: Nikolaus Harnoncourt, Regie: Martin Kusej (im Bild), Bühne: Rolf Glittenberg/Heidi Hackl. Mit Juliane Banse, Cornelia Kallisch, Alfred Muff, Shawn Mathey und Martin Ganter. [APA]
("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2008)